(iz). Ganze neue Töne in Berlin: Alle größeren muslimischen Verbände sitzen wieder an einem Tisch und begrüßen sogar gemeinsam die Neuausrichtung der Deutschen Islamkonferenz. Da muss man nicht lange herumreden: […]
Schlagwort: Islam
IZ-Gespräch mit Dr. Cornelia Schu von der Stiftung Mercator über die Aktivitäten der Körperschaft in Sachen Islam

(iz). Dr. Cornelia Schu ist seit 2010 bei der Stiftung Mercator tätig und leitet den Themenschwerpunkt Integration der Stiftung. Zuvor war sie sieben Jahre in verschiedenen Positionen in der Geschäftsstelle […]
Andersdenkende immer häufiger ein Dorn im Auge: Randaliererinnen von FEMEN stören Berliner Islamwoche

(iz). Es hätte ein ungestörter zweiter Abend der dreitägigen Berliner Islamwoche 2014 werden sollen. Zumindest hätte alles nach Plan verlaufen sollen, wäre es nach den OrganisatorInnen und den meisten Gästen gegangen. Das Event ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der muslimischen Gemeinschaft in der Hauptstadt geworden. Es zieht auch immer mehr Interesse von Seiten der Berliner Zivilgesellschaft an.
Nicht jedem passt das. Bereits im Vorfeld wurde in öffentliche Briefen und in einem Boulevardblättchen gegen diese neue deutsche Tradition aus der zweiten Reihe geschossen. In dem beunruhigenden Trend, Andersdenkende zu stören, anstatt mit ihnen zu diskutieren, reihten sich am Donnerstag, den 20. März auch Mitglieder des Demonstrationskollektivs FEMEN ein.
Mitten in ein Podiumsgespräch sprangen die leicht bekleideten Damen unerwartet auf die Bühne und hielten Banner hoch, auf denen sie ihren Unmut gegenüber den religiösen Ansichten anderer zum Ausdruckt brachten. Nach Berichten von Anwesenden und Mitgliedern des anwesenden IZ-Teams „muss ein großes Lob an die Veranstaltung ausgesprochen“ werden. Sie hätten abgewartet und angemessen reagiert. Die Unterbindung der Störung sei der Polizei überlassen worden. Nachdem die Randaliererinnen unter lautem Geklatsche und Gelächter abgeführt wurden, setzten die Teilnehmer ihre Diskussion fort.
Die Beobachtung eines Besuchers, wonach „heute sehr viel mehr Kameras als gestern vor Ort waren“, erhärtet die Mutmaßung Berliner Muslime, dass das keine spontane Unmutsbezeugung der FEMEN-Mitgliederinnen war. Verstärkt wird diese Ahnung durch die Deklaration der Organisation. Darin finden sich die stellenweise die gleichen Behauptungen und Formulierungen, wie sie schon in einem Brandbrief zu finden waren, der sich zuvor gegen die Organisatoren und ihre Gäste richtete. Dass FEMEN glaubt, ein Redner werde angeblich von einem „europäischen Verfassungsschutz“ beobachtet, belegt erneut, dass noch erheblicher Aufklärungsbedarf in der Islamdebatte besteht. (sw)
Gesetzesvorhaben des NRW-Landtages dürfte es muslimische Religionsgemeinschaften schwerer machen
(iz). Ein Gesetzesvorhaben in Nordrheinwestfalen (NRW) hat Muslime aufhorchen lassen. Die Landesregierung und alle im Landtag vertretenen Fraktionen planen, die Anerkennung von Religionsgemeinschaften zukünftig gesetzlich zu regeln. Neben dem Bekenntnis zur Verfassung sollen weitere zentrale Voraussetzungen detailliert geregelt werden.
Eine wichtig Voraussetzung wird etwa die Mitgliederzahl sein. Ein muslimischer Verband, der die Anerkennung als Religionsgemeinschaft erlangen will, muss demnach 17.500 Mitglieder vorweisen (mind. 1 Promille der NRW-Bevölkerung). Zudem muss die Gemeinschaft bereits seit mindestens 30 Jahren bestehen.
Auch bei einer Erfüllung dieser Voraussetzungen soll die Anerkennung keinesfalls garantiert sein. Denn der Landtag soll immer noch das Recht haben, eine Anerkennung als Körperschaft ausdrücklich „von seiner Zustimmung abhängig machen“, berichtete die Katholische Nachrichtenagentur (KNA).
Dieses Gesetzesvorhaben in dem Bundesland, in dem die meisten deutschen Muslime leben, ist ein Schlag ins Gesicht der im Koordinationsrat der Muslims (KRM) organisierten muslimischen Verbände. Denn schon seit Längerem liefen Verhandlungen zwischen den muslimischen Verbänden und der Landesregierung über eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Mit diesem Gesetzesvorhaben drohen diese Verhandlungen obsolet zu werden, denn keiner der großen Verbände dürfte ohne Weiteres die Voraussetzungen in diesem Gesetzesvorhaben erfüllen.
Es stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern die langjährigen Verhandlungen um die politische Anerkennung zu etwas Greifbarem geführt haben. Die Etablierung der Islamischen Theologie und der Islamische Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen wurden ja eben auch forciert, um diese politische Anerkennung voranzutreiben. Jetzt steht der organisierte Islam wieder vor einer Sackgasse.
Auffällig wurde in der letzten Zeit, dass insbesondere die DITIB – als größter Mitgliedsverband im KRM – systematisch eine einheitliche Linie torpediert, aber parallel dazu ihre Landesstrukturen entsprechend den gesetzlichen und politischen Voraussetzungen für eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft anpasst. Damit könnte sie in nicht allzulanger Zeit als erste und vielleicht sogar einzige muslimische Religionsgemeinschaft „anerkannt“ werden.
Im Grunde stellt sich für den Koordinationsrat die Sinnfrage. Genügt es wirklich nur, auf „Anerkennung“ zu setzen, aber gleichzeitig das eigentliche Projekt, die Muslime zu ihrem Wohl miteinander zu vernetzen, konsequent zu vernachlässigen? Am Ende könnte man so vor dem Staat und vor den Muslimen verlieren.
Berlin: Ex-Dialogbeauftragter von SPD-Stiftung macht gegen Islamwoche mobil

Berlin (iz). „Islamwochen“ sind in deutschen Städten oder Universitäten längst zum Alltag der regelmäßigen Begegnung zwischen Muslimen und der Mehrheitsgesellschaft geworden. Je nach Organisationsgrad und der Anzahl der Beteiligten entstehen so oft beeindruckende Veranstaltungsreihen. Nicht zufällig beteiligen sich daran seit einiger Zeit auch immer mehr Kommunen, die diese Begegnungsplattform zu schätzen gelernt haben.
Obwohl es diese Institution bei den hauptstädtischen Muslimen bereits seit geraumer Zeit gibt, haben die Veranstalter in den letzten Jahren das Format doch noch weiter entwickelt. In diesem Jahr findet das dreitägige Programm von der Initiative Berliner Muslime (IBMUS) und Islamic Relief vom 19. bis zum 21. März im berühmten Roten Rathaus statt; in Kooperation mit dem Berliner Senat. Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister der Hauptstadt, wird auf der Ankündigung mit einem Grußwort zitiert.
Unverständlicherweise scheint das aber nicht allen Zeitgenossen zu gefallen. So mancher vermutet dahinter einen perfiden Plan deutscher „Islamisten“. In einem online veröffentlichten Schreiben hat sich der pensionierte Verantwortliche für den so genannten „Interreligiösen Dialog“ bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Dr. Johannes Kandel, bei seinem Parteifreund Wowereit über die Kooperation des Senats mit den Berliner Muslimen beschwert.
In Kreisen der „Islamismus“-Experten Deutschlands ist das Vorgehen übrigens keine Seltenheit: Seit dem 2001 wurden Fälle bekannt, in denen der Austausch zwischen Mehrheitsgesellschaft und muslimischen Andersdenkenden Fachleuten übel aufgestoßen ist. Als Folge haben sich die Experten auch schon einmal vorab oder im Nachhinein darüber beschwert, wenn – ihnen unliebsame Muslime – als Redner oder Gäste bei hochklassigen Events geladen wurden.
Mit Verwunderung habe Kandel die „Kooperation der Staatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten mit den Veranstaltern der diesjährigen Islamwoche“ zur Kenntnis genommen. In einer, für die Berufsgruppe nicht untypisch aggressiven Wortwahl moniert der pensionierte Fachmann das Vorgehen der Senatskanzlei und unterstellte den Kooperationspartnern der Islamwoche, sich nicht ausreichend „bei der Abteilung Verfassungsschutz beim Innensenator“ informiert zu haben.
Kandel gelingt in seinem Brief der beeindruckende intellektuelle Spagat, einerseits „Dialog“ (bei dem er sich „seit Jahren“ engagiere) für „unverzichtbar“ zu erklären, und es andererseits anzukreiden, dass sich „islamistische“ beziehungsweise „konservativ-orthodoxe muslimische Gruppierungen“ an selbigem zu beteiligen.
Im Rahmen des klassischen Taqija-Vorwurfes, mit dem Muslime seit mehr als einem Jahrzehnt konfrontiert werden, unterstellt er – nicht zum ersten Mal – eine perfide Strategie. Ironisch ist dabei, dass der bekannte evangelikale Christ Kandel nun gerade Muslimen implizit Missionierung vorwirft.
Nicht nur hier scheint es in Deutschland Usus zu werden, den Andersdenkenden zu dämonisieren, anstatt sich direkt und persönlich mit ihm und seinen Argumenten zu beschäftigen. Die Dämonisierung aus der Halbdistanz ist gerade hier wichtig, um das Feindbild lebendig zu halten.
Link:
Interview mit dem Autoren Patrick Bahners („Die Panikmacher“)
Die Krimtataren zwischen europäischer Ignoranz und russischem Chauvinismus

(iz). Die Tataren auf der Halbinsel Krim wehren sich verzweifelt gegen eine Einverleibung durch die Russische Föderation, den Rechtsnachfolger des Deportationsregimes aus ihrer Vergangenheit. Sie schauen auf eine wechselvolle, oft schmerzhafte Geschichte zurück. Nach der Eroberung des islamischen Krim-Khanats 1783 durch Katharina II. war der endgültige Einschnitt in das Leben dieses Volkes die komplette Deportation am 18. Mai 1944 durch das Sowjetregime Stalins. Seit Glasnost und Perestroika sind über 300.000 Krimtataren auf ihre Insel zurückgekehrt. Seit Beginn der Repatriierung verfolgen sie einen strikt gewaltfreien Kurs auf Demokratisierung der Ukraine und eine Assoziierung mit der EU.
Eskalation durch Provokation
Ali Khamzin, Außenbeauftragter des Nationalrates der Krimtataren Milliy Medschlis, kommt in den letzten Tagen kaum zum Schlafen: Gestern früh war Stadtzentrum ist gesperrt, Ministerrat und Parlamentsgebäude wurden von irregulär bewaffneten Russen besetzt, niemand weiß, wer diese Männer wirklich sind. Die Flaggen Russlands wurden auf den Gebäuden gehisst. Es heißt, sie seien mit Lkw aus der vorwiegend von Russen bewohnten Stadt Sewastopol gekommen, wo seit Tagen verstärkt russische Pässe und Waffen vergeben werden und prorussische Demonstrationen stattfinden. Khamzin und die Führung des Medschlis, dass sich die krimtatarische Bürgerbewegung jedoch nicht provozieren lässt und hofft, dass sich die Zentralregierung in Kiew so schnell wie möglich und intensiv um diese Eskalation kümmert. Jedoch gibt es dort im fernen Kiew erst seit zwei Tagen eine Regierung und diese hat mit sich selbst zu tun. Genau dieses Vakuum haben anscheinend die russischen Besetzer in Simferopol ausgenutzt für ihre gestrige Nachtaktion.
Erschreckend ist teils die Überforderung der Medien vor Ort. Es brauchte einige Zeit, bis realisiert wurde, dass die EuroMaidan-Kräfte auf der Krim vor allem die Tataren sind. Weder bei NTV noch anderen großen Stationen schien aufzufallen, dass die Plakate keine Parolen in kyrillischer Schrift enthielten, sondern in lateinischer Schrift. Also kein Russisch, kein Ukrainisch, aber was dann?
Krimtatarisch eben, die Sprache der größten ProEuropa-Kraft der Krim: Die Krimtataren, exzellent organisiert, beharrlich gewaltfrei aber strikt ukrainisch integrativ. Oder wie es Prof. Dr. Kerimov gerne ausdrückt: „Die besten Ukrainer auf der Krim sind die Tataren.“ Er leitet das Forschungszentrum für Sprache, Geschichte und Kultur der Krimataren an der KIPU-Universität Simferopol und verweist auf die komplizierte Gemengelage auf der Krim. Durch jahrhundertelange Repression und gezielte Ansiedlung von Slawen auf der Krim, seien die indigenen Nationalitäten der Krimtataren, Karaimen und Krimtschaken eine numerische Minderheit im eigenen Land geworden. Neben rund 60 Prozent Russen leben nur knapp 15 Prozent Ukrainer und 15 Prozent Tataren auf der Krim – neben Dutzenden kleinen Volksgruppen wie den Krimdeutschen, Ungarn, Karaimen …
Wenn in Umkehrung aller Tatsachen sogar der deutsche staatliche Sender Phönix live berichtet „dass die Krim eigentlich schon immer russisches Gebiet war“ und mutmaßt, „wenn die Tataren jetzt die Regierungsgebäude eingenommen haben, und dabei Menschen ums Leben gekommen sind, weiß man zunächst einmal nicht, wie es hier weiter geht“, zeigt dies die Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit deutscher Osteuropa-Korrespondenten. Doch auch Politiker offenbaren ihre eurozentristische Weltsicht und völlige Ahnungslosigkeit.
Ahistorisch behauptete etwa Phillip Mißfelder, außenpolitischer Sprecher der CDU: „Die geostrategische Frage der Krim ist für Moskau sehr emotional, da es sich historisch um den Kernbereich Russlands handelt.“ Kernbereich Russlands? Schon immer russisches Gebiet? Diese frappanten Äußerungen stehen stellvertretend für zwei grundsätzliche Probleme: Die fehlende mediale Vertretung ausländischer Presse in der Ukraine generell und zweitens die Ignoranz oder Mainstream-Westeuropa-Perspektive auf die Geschichte Osteuropas durch hiesige Eliten in Medien und Politik.
Der weiße Fleck Ukraine in europäischer Wahrnehmung
Dass die Ukraine ein eigener Staat mit durchaus langen Traditionen und Teil Europas ist, setzt sich nur langsam im Bewusstsein der deutschen Allgemeinheit durch. Und dass die Krimtataren eines der ältesten islamischen Völker Europas sind mit traditionell engen Verbindungen in die Türkei und nach Deutschland, ist trotz einiger Zeitungsberichte der letzten Jahre in Deutschland nahezu unbekannt. Prof. Dr. Andreas Umland von der Nationalen Universität Mohyla-Akademie in Kiew schreibt dazu in seinem Artikel „Weißer Fleck. Die Ukraine in der deutschen Öffentlichkeit“, während sich in Moskau Dutzende Korrespondenten tummeln würden, ließen sich die mehr oder minder kontinuierlich in Kiew arbeitenden deutschen Journalisten an einer Hand abzählen: „Die ohnedies spärliche deutsche Ukraine-Berichterstattung findet zumeist von Warschau und Moskau aus statt. Spezialisierte deutsche Informationsdienste wie die Ukraine-Analysen (Bremen) oder Ukraine-Nachrichten (Kiew) werden – im Gegensatz zu vergleichbaren Internetprojekten wie den Russland-Analysen (Bremen) oder Russland-Aktuell (Moskau) – nur von einem engen Interessentenkreis genutzt.“
Dem abzuhelfen, kann zumindest ein positiver Nebeneffekt der jetzigen Umwälzungen sein: Viele Veranstaltungen zur Situation in der Ukraine finden derzeit in Deutschland statt. Auch die Krimtataren finden so mehr Erwähnung als in der Vor-Maidan-Zeit. Wie viel davon letztendlich nachhaltig den Bekanntheitsgrad des kleinen Volkes steigern kann, bleibt abzuwarten, denn die Reporter-Karawane wird weiter ziehen, die Probleme vor Ort bleiben.
Traumatische Geschichte europäischer Muslime
Um diese Probleme verstehen zu können, muss man sich wohl oder übel die Mühe machen und in die europäische Geschichte der vergangenen Jahrhunderte zurück schauen. Über tausend Jahre, ab dem siebten Jahrhundert u.Z., dominierten Turkvölker das Gebiet zwischen dem heutigen Usbekistan und Moldawien. Nach den Reichen der Awaren, Chasaren, Kiptschaken und Bolgaren prägten die Tataren über drei Jahrhunderte den nördlichen Schwarzmeerraum. Erst Katharina die Große brach mit der russischen Annexion der Krim im Jahre 1783 diese lange Geschichte. Durch Repression, Russisch-Osmanische Kriege und die Revolution der antireligiösen Bolschewiki, deren Rotem Terror und dem Hunger-Genozid Holodomor in den 1930 Jahren schmolz die tatarische Bevölkerung auf die Größe einer Minderheit.
Der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt, wurde das ganze Volk dann 1944 in Viehwaggons gen Osten deportiert. Russisches Kernland ist die Krim nie gewesen, jedoch in der russischen Idee des dritten Rom als Legimitation der Macht spielte sie immer eine große Rolle. Mit den vielen griechischen Hinterlassenschaften und der subtropischen Südküste war sie seit der Eroberung „Die Perle des Imperiums“. Erst Nikita Chrustschows Schenkung der Krim als Freundschaftsbeweis der Russen an die Ukrainische SSR machte die Krim zu einer ukrainischen Gebietseinheit, was zu UdSSR-Zeiten kaum jemanden störte oder eine Rolle spielte, avancierte nach dem Zerfall der Sowjetunion zum Zankapfel zwischen Moskau und Kiew. Immer dazwischen: die Krimtataren.
Deutsch-Krimtatarische Beziehungen älter als Deutschland
Historisch eng sind die Beziehungen der Krimtataren zu Deutschland beziehungsweise vorher zum Ordensstaat der Kreuzritter, zu Brandenburg-Preußen und Sachsen seit den 1420er Jahren. Belegt sind über ein Dutzend Gesandtschaften, angestrebte Militär-Allianzen sowie und Anwerbung krimtatarischer Reiter für die Preußische Armee, „Durchlauchtigster Bruder, Herrscher der Europäischen Tataren“ nannte den Krim-Khan der Große Kurfürst. Trotz der Annektierung der Krim bewahrten sich die Krimtataren durch Zaren- und Sowjetzeit hindurch ihre Religion, den Islam, ihre Sprache und Kultur. Aufgrund der massenhaften Auswanderung gibt es heute Krimtatarische Gemeinden fast überall auf der Welt, vor allem in der Türkei (2 bis 4 Millionen), Usbekistan, Rumänien, Bulgarien und Deutschland.
Der Weltkongress der Krimtataren hält die Fäden international zusammen und jedes Jahr zum Tag der Deportation am 18. Mai gibt es eine zentrale Kundgebung in Gedenken an den Genozid, die Hälfte des Volkes wurde 1944 ermordet oder kam an Hunger, Entkräftung und Kälte zu Tode. Aus jeder Diasporagemeinde ist mindestens ein Vertreter in den Weltkongress gewählt und auch der Milliy Medschlis (Nationalrat) der Krimtataren auf der Krim selbst hat Diasporaabgeordnete in seinen Reihen. In Deutschland ist der Journalist Ahmet Özay zuständig für krimtatarische Belange. In den letzten Monaten gab es da viel zu tun. Gespräche mit Abgeordneten, Politikern im Auswärtigen Amt, mit der Presse und Politikern des EU-Parlamentes galt es zu organisieren und zu moderieren.
Die geschürte Angst der Russen auf der Krim sei völlig unbegründet, so Ahmet Özay: „Wir nehmen niemandem etwas weg. Wir haben nur diese eine Heimat und möchten dort friedvoll mit allen Nachbarn wohnen. Es gab nie Rückgabeansprüche an ukrainische und russische Menschen auf der Krim, die nach der Deportation in unsere Häuser einzogen.“ Die deutsche Politik jedoch müsse Jenseits von Lippenbekenntnissen aktiver bei der Unterstützung der Krimtataren werden. Willensbekundungen wie im Brief von Hans Joachim Gauck vom November 2013 oder bei Gesprächen im Auswärtigen Amt vor drei Wochen reichten hier nicht aus.
Die deutsch-krimtatarischen Beziehungen werden seit Jahren auf dem Gebiet Wissenschaft und Kultur vertieft. Im letzten Jahr gab es allein in Deutschland vier Konferenzen dazu und 2014, aus Anlass des 70. Jahrestages der Deportation der Krimtataren wird es ebenfalls Symposien, Vorträge und Kulturveranstaltungen in Deutschland geben, maßgeblich unterstütrzt durch die Initiative „Deutsch-Krimatatrischer Dialog“ (http://qirimdialog.wordpress.com).
Die „großen Brüder“ Türkei und Tatarstan
Viele Treffen von Ministerpräsident Erdoğan und ukrainischen Politikern in der Vergangenheit fanden zusammen mit Vertretern der Krimtataren statt. Sie sind die Mittler zwischen den Nachbarn am Schwarzen Meer und haben der krimtatarischen Diaspora in der Türkei als auch staatlichen Institutionen dort sehr viel zu verdanken.
Umso enttäuschter war jetzt Ali Khamzin, Außenbevollmächtigter des Milliy Medschlis, von der Note des türkischen Außenministers Davutoğlu, die er gestern Abend mit dem Präsidenten der russischen Teil-Republik Tatarstan verfasste. Über Allgemeinplätze zur Beruhigung der Lage ging das Statement nicht hinaus. Und warum gerade mit Tatarstans Präsident Minikhanov?
Er ist zwar Tatare, aber Wolga-Tatare, mit den kleinen Brüdern auf der Krim hat die wolga-tatarische Politik jedoch so ihre Schwierigkeiten, sind die Krimtataren doch strikt gegen jede russisch-imperiale Attitüde und kämpferisch im Auftreten für die eigenen Rechte. Die Wolgatataren jedoch sind – aufgrund ihrer zentralrussischen Siedlungssituation seit Jahrhunderten russischer Politik direkt untergeordnet und immer zu Kompromissen genötigt. Auch zu den wolga-tatarischen Bewohnern der Krim ist das Verhältnis eher kühl. Sind dies doch meistens ehemalige Sowjetoffiziere und Geheimdienstler.
Der Aufruf von Minikhanov und Davutoğlu zeige jedoch den großen Einfluss der Weltpolitik auf den Regionalkonflikt auf der Krim und die Bedeutung der Krim in internationaler Geostrategie.
Hoffnung und Engagement
Professor Kerimov hofft, dass die Eskalation der letzten zwei Tage schnell überwunden wird und die Arbeit an Universitäten und Akademien der Krim wieder aufgenommen werden kann. Er arbeitet derzeit an Projekten zu deutsch-krimtatarischer Geschichte und geplant sind Konferenzen, Bücher und Dienstreisen nach Deutschland. Auch Dschemile Umerova-Ibragimova, sie studiert Regierungsmanagement an der Taurida-Universität Simferopol, hofft, dass sich die Polizei neutral verhält und die separatistischen Bestrebungen und Losungen wieder aufhören. Schließlich leben auf der Krim über 100 Nationalitäten und bisher habe man auch friedlich zusammen gelebt.
Der krimtatarische Nationalrat Milliy Medschlis hat zusammen mit Staatsanwaltschaft und Sicherheitsbehörden der Krim einen gemeinsamen Krisenstab gegründet um den separatistischen Parlamentsbesetzern konzertiert entgegentreten zu können. Der neue ukrainische Innenminister, Arsen Awakow, erklärte auf seiner Facebook-Seite, man werde diese Besetzung nicht hinnehmen. Miliz und Truppen des Innenministeriums seien in höchster Alarmbereitschaft.
Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen Terrorismus ein. Übergangspräsident Turtschinow bezeichnete die Besetzer als „Verbrecher“. Er habe den ukrainischen Sicherheitskräften befohlen, die Gebäude zurückzuerobern.
Zur gleichen Zeit in Brüssel: Emine Bozkurt, EU-Parlamentsabgeordnete der Niederlande, verlangte dort heute: „Wir müssen heute klar Stellung beziehen, dass Demokratie und Menschenrechte für alle Ethnien in der Ukraine gelten müssen. Die Achtung der Identität und Sprache der Minderheiten und die nationale Integrität der Ukraine sind strikt zu achten… Die Krimtataren, die sich ihre Rechte auf Bildung, Muttersprache, eigene Kultur und Landbesitz mühsam erkämpft haben, stehen jetzt vor dem Risiko diese Errungenschaften wieder zu verlieren! Den Unruhen auf der Krim dürfen wir nicht den Rücken zuwenden!“
Auch die Intellektuellen auf der Krim bangen um die Zukunft ihrer Insel. Der Hauptdarsteller des Films „Haytarma“ (Heimkehr), Achtjom Seytablayev, sagte zur Situation auf der Krim: „Wir haben keine andere Heimat, dies ist unser Mutterland, wir möchten frei in der Ukraine leben.“ Haytarma ist der erste abendfüllende krimtatarische Spielfilm, seine Uraufführung in Deutschland fand im Herbst 2013 in Berlin statt, mit dabei waren krimtatarische Studierende aus Deutschland, der ukrainische Botschafter und Gäste von der Krim, Temur Kurshutov und Ismail Kerimov vom Forschungszentrum an der KIPU-Universität.
Ob und wann die deutsch-krimtatarische Zusammenarbeit in Kultur und Wissenschaft weitergehen wird, ist momentan ungewiss. Erst einmal muss sich die Lage auf der Krim beruhigen und stabilisieren, so Ali Khamzin vom Nationalrat in Aqmescit/Simferopol. „Und dafür brauchen wir auch Deutschland!“
* Der Autor ist Direktor des Institutes für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien Magdeburg.
Interview mit dem krimtatarischen Abgeordneten Ali Khamzin: „Zur europäischen Ukraine wird die Krim dazugehören“

(iz). Ali Khamzin gehört zum Volk der Krimtataren und wurde 1958 in Usbekistan geboren, wohin die Krimtataren 1944 von Stalins Sowjetregime deportiert wurden, der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt. Seit ende der 1980er Jahre kehren die Krimtataren in ihre alte Heimat zurück, wo es seitdem immer wieder zu Konflikten mit den russischsprachigen Bewohnern kommt, die nach 1944 dort angesiedelt wurden. Etwa 300000 Krimtataren leben wieder auf der Krim und stellen damit 15 Prozent der Bevölkerung.
Rund 150.000 Krimtataren leben noch in den Deportationsgebieten Zentralasiens. Khamzin ist Mitglied des krimtatarischen Nationalrates Milliy Medschlis, der aus 33 Personen besteht und der das Organ für die krimtatarische Selbstverwaltung darstellt. Dort ist Khamzin für die Außenbeziehungen und Staatsbürgerschaftsfragen zuständig. Er lebt mit Frau, Kindern und Enkeln in Bachtschisaray, der alten Hauptstadt der Krim-Khane.
Mit ihm sprachen wir über die Position der Krimtataren angesichts der momentan brisanten Lage in der Ukraine und welche politischen Optionen sich für die Tataren zukünftig bieten.
Islamische Zeitung: Herr Khamzin, in der Ukraine, auf der Krim eskalierte die Gewalt, das Parlament wurde von bewaffneten Russen besetzt. Wie geht es jetzt weiter auf der Krim?
Ali Khamzin: Wichtig ist, sich nicht provozieren zu lassen. Hätten wir dies in der Vergangenheit zugelassen, wäre es schon häufig zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen. Wir haben der Krimbevölkerung empfohlen nach der Besetzung von Ministerrat und Parlament durch russische irregulär Bewaffnete zu Hause zu bleiben, sich nicht provozieren zu lassen. Darauf zielen solche Aktionen ja ab.
Islamische Zeitung: Warum?
Ali Khamzin: Nach der Deportation von uns Krimtataren 1944 wurde die Krim mit demobilisierten sowjetischen Dienstgraden bevölkert, von den normalen Reservisten der Armee bis hin zu ausgemusterten KGB-Leuten. Deswegen ist die Krim heute ein Sammelbecken von Chauvinisten, von Sowjetnostalgikern und Leuten, die Putin hörig sind. Für diese Kräfte ist die Krim Bestandteil „heiliger russischer Erde“.
Islamische Zeitung: Was passiert nun bei Ihnen in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, sind bewaffnete Auseinandersetzungen zu befürchten?
Ali Khamzin: Wir Krimtataren, auf der Krim sind wir insgesamt etwa 300.000 Menschen, haben eine starke Selbstverwaltung, den Milliy Medschlis (Nationalrat). Unter dessen Vorsitzenden Refat Tschubarov haben wir zusammen mit ukrainischen Rechtsorganen wie der Staatsanwaltschaft und der Dachorganisation „Krimskiy Euromaidan“ einen Krisenstab gegründet, um mit der Situation professionell umgehen zu können. Vertreter der OSZE sind bereits unterwegs auf die Krim.
Islamische Zeitung: Die Krimtataren befürworten also klar den Umbruch in der Ukraine?
Ali Khamzin: Wir Krimtataren sind Europäer, haben eine europäische Mentalität. Wir bekennen uns zu europäischen Werten, zu den demokratischen Prinzipien, zu Menschenrechten und zum Schutz von Minderheiten. Mustafa Dschemiliw, einziger krimtatarischer Abgeordneter der Hohen Rada in Kiew hat wiederholt auf dem EuroMaydan gesprochen und betont: „Die Krimtataren haben nur eine Perspektive: In einer demokratischen Ukraine als freies Volk in einem geeinten Europa der Menschenrechtsstandards und der kulturellen Vielfalt zu leben“. Daher unterstützen wir auch die europäische Ausrichtung der Ukraine und das Assoziierungsabkommen mit der EU. Und zu dieser europäischen Ukraine wird die Krim dazugehören.
Islamische Zeitung: Besteht aber nicht die Gefahr der Abtrennung der östlichen Ukraine und der Krim?
Ali Khamzin: Dass sich der Südosten der Ukraine, der Donbass, der Schwarzmeerraum und die Krim abspalten wollen, ist medial überbewertet und verkennt die Stimmung unter der Jugend. Natürlich gibt es in Gebieten wie Luhansk, Charkiw, Donezk, chauvinistische Kräfte. Sie gibt es besonders wieder, seitdem Wladimir Putin an der Macht ist. Aber man darf eines nicht unterschätzen – die Jugend hat sich völlig verändert. Viele der Jüngeren waren im Westen, haben Verbindungen via Internet, haben gesehen, wie die Menschen leben, sehen täglich, wie eine europäische Ukraine aufgebaut sein kann.
Islamische Zeitung: Woran machen Sie dies fest?
Ali Khamzin: Schauen Sie sich die Bilder von den Toten auf dem Maidan an. Das sind alles junge Gesichter. Diese Männer wollten nicht mehr nach sowjetischen Prinzipien leben. Und auch vor dem Osten der Ukraine macht das nicht Halt. Der Gouverneur von Charkiw kommt nicht mehr in seine Büros, weil das Gebäude seit Tagen von jungen Leuten belagert wird. Auch dort ist die EuroMaydanbewegung präsent.
Islamische Zeitung: Aber Abtrennungsszenarien stehen im Raum?
Ali Khamzin: Eines muss den Medien im Westen klar gesagt werden: Die einfache Trennung in pro-russischen Osten und pro-europäischen Westen gibt es so nicht und eine Sezession kann nicht funktionieren. Aber auch den Leuten in Kiew auf dem Maidan und in der Regierung muss ganz deutlich sagen: Wenn es uns Krimtataren nicht gäbe, gehörte die Krim längst nicht mehr zur Ukraine. Das Anheizen der Stimmung durch russische Politiker, die hier auf die Krim gekommen sind, und durch die russischen Medien fallen bei manchen auf fruchtbaren Boden, doch einige hundert russische Nationalisten sind nicht das Abbild der Krim.
Islamische Zeitung: Welche Personen sehen Sie als politische Akteure der Zukunft?
Ali Khamzin: Eine Mischung aus den Kräften der Orangenen Revolution von 2004 und neuen Leuten des Euromaidan von heute muss die Ukraine geeint eine europäische Perspektive geben. Angebote dafür aus der EU heraus gibt es ja.
Islamische Zeitung: Hat sie Ihr Engagement für die Orangene Revolution 2004 etwas gelehrt?
Ali Khamzin: Ja sicher, damals mussten wir alle Hoffnungen beerdigen. Dennoch war die Orangene Revolution nicht vergeblich. Denn ohne Orangene Revolution gäbe es heute keinen Euromaidan. Und zu seinen Akteuren gehören Vitali Klitschko, Arsenij Jatzeniuk und auch Oleh Taghnibok von der Partei „Swoboda“. Und Julia Timoschenko wird bestimmt auch einen Platz finden. Wir als Krimtataren haben keine andere Option als „Pro-Europa“, wir haben keine andere Heimat und nur eine starke demokratische Ukraine kann unser Forstbestehen garantieren.
Islamische Zeitung: Was ist, wenn auch dieser Aufbruch scheitert?
Ali Khamzin: Die Menschen der neuen Regierung haben eine große Verantwortung. Denn wenn das so ausgeht wie bei der Orangenen Revolution wird es die Ukraine in dieser Form nicht mehr geben. Wir werden also mit aller Kraft weiter für unser Projekt eines Internationalen Forums werben, auf dem die Probleme der Krim zusammen mit ukrainischer Regierung, europäischen und internationalen Institutionen diskutiert werden sollen. Das richtet sich nicht gegen Rußland oder gegen die Zentralregierung in Kiew sondern zielt auf die gemeinsame Lösung der immensen Probleme hier.
Islamische Zeitung: Vertrauen Sie den neuen politischen Führern in Kiew?
Ali Khamzin: Wir kämpfen seit unserer Rückkehr auf die Krim vor über zwanzig Jahren für unsere Rechte. Jede Schule, jedes Stück Land, jedes Buch der Krimtataren sind mühsam erarbeitet. Und ehrlich gesagt misstraue ich tief im Inneren auch ein wenig den politischen Gewinnern des Euromaidan. Wir Krimtataren haben eine andere Kultur und eine andere Religion. Wir sind Muslime und ich habe die Befürchtung, dass uns der Euromaidan und die neue Regierung wieder genauso nachlässig behandelt, wie es die Präsidenten Juschschenko und Janukowitsch vor ihnen getan haben.
Für dieses Interview bedanken wir uns recht herzlich bei Dr. Mieste Hotopp-Riecke vom Magdeburger Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien.
Mit der Islamischen Akademie wollen junge Muslime „islamisches Wissen aufbauen und erneuern“
„Wir leben im digitalen Informationszeitalter! Fakt ist jedoch, dass mit mehr Information nicht mehr Erkenntnis an die Menschen gelangt. Durch diese Informationsüberflutung entsteht nur ein ‘Chaos der Gedanken’. Genau an diesem Punkt setzen wir an!“ (Islamische Akademie Deutschland e.V.)
(iz). Wir leben in Zeiten einer Kakophonie von Meinungen und umfundierten Ansichten. Das betrifft die Gesamtgesellschaft, aber auch die vielfältige muslimische Gemeinschaft. Für sie allerdings hat das noch negativere Auswirkungen, kann Allah doch ausschließlich durch Wissen korrekt angebetet werden. Egal ob jemand sich dem so genannten „Mainstream-Islam“ verbunden fühlt oder an einem der vielen Ränder der Community irrlichtet, immer häufiger wird es zur Gewohnheit, dass Aussagen über wichtige Aspekte unserer Religion und Lebensweise nicht auf fundiertem Wissen beruhen, sondern auf Meinungen. Man bekommt so das Gefühl, dass viele Muslime heute ihre eigenen Imame, Qadis und Schaikhs sind.
Es hat bisher nicht den Anschein, dass die entstehende „Islamische Theologie“ daran etwas wird ändern können oder wollen. Auch aus diesen Gründen ist es wichtig, dass sich die dynamische muslimische geistige Elite – frei von ausländischer Beeinflussung – um die Bewahrung und Weitergabe des Mehrheits-Islam und seiner Wissenschaften bemüht. Eines dieser Projekte, dass seinem Eigenverständnis nach „eine wissenschaftliche Institution“ sein will, ist die Islamische Akademie Deutschland e.V. (IAD) Der eingetragene, gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Frankfurt. Die IAD versteht sich als „unabhängige Vereinigung von jungen Theologen und Religions- sowie Islamwissenschaftlern, die auf der Basis des sunnitischen Islam ihren Beitrag“ zum Aufbau der Islamwissenschaften in deutscher Sprache leisten will. Die IAD-BetreiberInnen verstehen sich als „idealistisches Team aus jungen Wissenschaftlern. (…) Wir sind ideologisch und organisch unabhängig von jeder Gruppe, aber erstreben dennoch eine Zusammenarbeit“. Angesichts des existierenden Eigenbrötlertums in der Community bleibt ehrlich zu hoffen, dass die jungen Akademiker mit ihrem Bestreben Erfolg haben. Immerhin, ihr Ziel ist kein geringeres als „die Wiederbelegung islamischer Wissenschaften in deutscher Sprache“.
Im Wesentlichen stehen „Forschung, Bildung und wissenschaftliche Begleitung der muslimischen Gemeinschaft“ im Zentrum der Absichten vom IAD und ihren GründerInnen. Aus diesem Grund sei die muslimische Jugend eine der „Zielgruppen der Akademie“. IAD-Mitglieder würden sich in der Jugendarbeit betätigen und „helfen Jugendlichen bei der Entdeckung und Entfaltung der eigenen Fähigkeiten“. Im Hinblick auf junge Muslime gehe es dem Verein um „den Aufbau einer deutsch-muslimischen Identität“ sowie Prävention von „Kriminalität“ und „jeglicher Radikalität“.
Die Arbeit der Akademie behandelt im Kern das Wissen und seine verschiedenen Aspekte. Dazu gehört auch, so eine verfügbare Präsentation über die Vereinsarbeit, dass es heute durch verschiedene Dinge bedroht werde: Zerstückelung der Wahrheit, was zur Aufhebung der „geistigen Einheit“ führe, Zerstreuung des Wissens, was unter anderem zu Gruppenfanatismus führe, sowie die allgemeine Informationsüberflutung. Gleichzeitig ergäben sich aus der deutschen Situation „neue Herausforderungen“ für das islamische Wissen: Relativierung von Wahrheit, Adaption des Wissens sowie der Kontext des „Islam in Deutschland“.
In der Behandlung des Wissens identifiziert die Islamische Akademie Deutschland e.V. neun Schritte: Sammlung, Kategorisierung, Katalogisierung, Sichtung, Rezeption, Systematisierung, Aktualisierung und Erweiterung, Erstellung eines Kontextes sowie seine Vereinheitlichung und Harmonisierung. Wichtig ist der Akademie dabei einerseits die Rückbindung an die Methodenlehre der islamischen Wissenschaften, andererseits will sie aber auch zu einer „Erneuerung“ dieser Wissenschaft sowie zur „Entwicklung einer deutschsprachigen Islamterminologie“ beitragen. Die Islamdebatten der letzten beiden Jahrzehnte, insbesondere die Vereinnahmung von tradierten Begrifflichkeiten durch extreme Randgruppen, belegt gerade die Bedeutung dieses Anliegens.
Nach eigenen Angaben betreibt der Verein „Grundlagenforschung als Beitrag für den Aufbau der Islamwissenschaften in deutscher Sprache“. Außerdem wolle man als Brücken zwischen jener Wissenschaft und der Gesellschaft fungieren, wobei „gewonnene Erkenntnis und erarbeitetes Wissen (…) auch für die Allgemeinheit aufgearbeitet werden soll“.
„Hierbei dienen neben populärwissenschaftlichen Publikationen auch Veranstaltungen wie Vorträge, Lesezirkel etc. als ein wichtiges kommunikatives Medium. Die Vision der Akademie ist eine ‘Meta-Universität‘ zu werden, das heißt, zum Beispiel Wissen und Forschung für die Erwachsenenbildung auch außerhalb der Universität zugänglich zu machen. In diesem Rahmen wird auch die Webseite Islam-auf-deutsch.de betrieben, die ebenso aktiv in Sozialen Medien (Facebook, Twitter) ist.“
Webseiten:
islam-auf-deutsch.de
islam-akademie.de
Unsere Sicherheitsdienste und ihr Umgang mit dem „Feind“
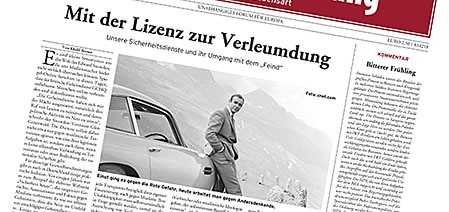
(iz). Es sind kleine Sensationen aus der Welt des Edward Snowden, die uns Medienmacher leider nicht wirklich überraschen können. Spiegel-Online berichtet in diesen Tagen, dass der britische Geheimdienst GCHQ unliebsame Menschen online verleumden und diskreditieren wollte.
„Die Geheimdienste haben sich mit der Macht ausgestattet, vorsätzlich den Ruf von Leuten zu ruinieren und deren politische Aktivität im Netz zu stören“, schreibt der Snowden-Vertraute Glen Greenwald. Die Dienste sollen dabei nicht etwa nur gegen muslimische Terroristen agieren, was eine ihrer legitimen Aufgaben ist, sondern auch dann, wenn es keine erkennbare Verbindung zu Terrorismus oder einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt.
Für derartige Grenzüberschreitungen gibt es auch in Deutschland einige praktische Indizien. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel die dubiose Webseite „Sicherheit heute“, die ungeniert Gerüchte, Assoziationen und Fakten gegen Muslime verbreitete. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Seite im Umfeld von einschlägigen Geheimdiensten agierte. Einige prominente IslamkritikerInnen in Deutschland sind auch heute noch offen für „Vorfeldorganisationen des Verfassungsschutzes“ aktiv und „agitieren mit Tatsachen“ – natürlich ohne jede Transparenz bezüglich ihrer eigenen Finanzierung, auch gegen Muslime. Ihre Unabhängigkeit muss selbstverständlich in Frage gestellt werden, zumal sie die Ausrichtung von Verfassungsschutzberichten immer wieder mitbeeinflussen konnten.
Auch diese Zeitung wurde, ausschließlich mit dem Ziel der Rufschädigung, in diversen VS-Berichten in die Nähe des unbestimmten „Islamismusbegriffes“ gerückt. Es mag hierzulande muslimische Verbrecher oder muslimische Ideologen geben, der unbestimmte Begriff des „Islamismus“ ist aber geradezu eine Einladung, Andersdenkende mit Terror in Verbindung zu bringen und so – insbesondere im Internet – zu verleumden. Natürlich sind von diesen Machenschaften längst nicht nur Muslime betroffen, wir sprechen hier über ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Auch der Bremer Rechtsanwalt und Bürgerrechtsaktivist Ralf Gössner kann zum Beispiel ein Lied davon singen, wie leicht man in Deutschland – 38 lange Jahre – Ziel einer Überwachung wird und wie lange es dauern kann, sich mit Hilfe von Gerichten von dieser Rufschädigung wieder zu befreien. Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft und an echter Kritik interessierte Journalisten sich von den subjektiven Motiven der „Panikmacher“ distanzieren. Mit anderen Worten, Kritik muss sein, aber offen und fair.
Begehrt von EU und Russland gleichermaßen: Ein Land zwischen Staatsbankrott und Revolution

(iz). Ich ziehe Revolution dem Krieg vor, zumindest nehmen an der Revolution nur die teil, die wollen“, hat einmal Marcel Proust angemerkt. Bis zu 20.000 Menschen haben auf dem Kiewer Maidan Platz Geschichte geschrieben und unter Einsatz des eigenen Lebens die Verhältnisse in der Ukraine nachhaltig verändert. Dutzende Demonstranten mussten ihren Einsatz für den Sturz des Regimes Janukowitsch mit ihrem Leben bezahlen. Vor den Fernsehern Europas herrschte Empörung über die brutale Hatz auf die Demonstranten. Allerdings fällt die abschließende Bewertung der „Revolution“ noch immer nicht ganz einfach. War das Geschehen in Kiew nun wirklich eine Revolution, oder doch eher eine feindliche Übernahme, ein Coup d’état, ein Coup de banque oder eben nur Teil eines profanen Staatsbankrottes?
Fakt, ist, dass nur ein kleiner sichtbarer Teil der Bevölkerung am Geschehen beteiligt war, wenn man auch das Schweigen der Mehrheit wohl als Zustimmung zum Umsturz interpretieren kann. Es fällt auch auf, dass im Gegensatz zum klassischen Bild einer Revolution, die Eigentumsverhältnisse im Lande unberührt blieben. Ohne sich auf das Glatteis der Verschwörungstheorien begeben zu wollen, muss man schon fragen: „Gab es ein Drehbuch für die Revolution und wenn ja, wer hat es geschrieben?“
Argwohn herrscht schon länger, nicht nur auf Seiten Russlands, wer die aktuellen „Techniker des Staatsstreiches“ in Kiew in den letzten Jahren in Position gebracht hat. Curzio Malaparte hat die Voraussetzungen dieser Art der Revolution, die keine Mehrheiten benötigt, in seinem berühmten Buch über den Staatsstreich so zusammengefasst: „Der Aufstand wird nicht mit Massen gemacht, sondern mit einer Handvoll Männer, die, zu allem bereit, in der Aufstandstaktik ausgebildet sind und trainiert, gegen die Lebenszentren der technischen Organisation des Staates schnell und hart zuschlagen.“
Die chaotischen Entwicklungen in Kiew machen uns jedenfalls – nach den verheerenden Balkankriegen der 1990er Jahre – wieder einmal schmerzlich bewusst, dass es auch in Europa weiterhin Optionen für Kriege und Bürgerkriege gibt. Wieder ist dabei mit der Ukraine ein überaus kompliziertes Staatsgebilde betroffen, ein Vielvölkerstaat mit einer so komplizierten Geschichte und einer grundsätzlichen“Minderheitenproblematik“. Jederzeit kann dabei ein neuer „Nationalismus“ sich auch gegen Muslime und Juden richten.
Nach der offiziellen Volkszählung 2001 leben im riesigen Staatsgebiet der Ukraine 77,8 Prozent Ukrainer, 17,3 Prozent Russen und über 100 weitere Nationalitäten. Die Unterschiede zwischen Ethnien und Religionen wurden unter den schlimmen Verhältnissen der kommunistischen Diktatur nicht ausgelebt.
Seit Jahrhunderten befindet sich aber die Region immer wieder im Konflikt mit Polen, Russen oder Deutschen. Bis in das 21. Jahrhundert lässt sich natürlich auch der geschichtliche Grundkonflikt zwischen dem Machtanspruch der orthodoxen Kirche und dem aufstrebenden Islam in der ukrainischen Geschichte nachzeichnen.
Es ist naheliegend, dass ohne das genaue Studium der Nachwirkungen dieser Geschichten, das kollektive Bewusstsein der Ukrainer unverstanden bleiben muss. Gerade aus deutscher Sicht ist das Verhältnis zu dem Land in Osteuropa schwer belastet. Im Zweiten Weltkrieg war die Ukraine nicht nur im Zentrum der expansiven „Lebensraum“-Philosophie der Nationalsozialisten, sondern auch der Schauplatz rigoroser Judenverfolgungen. Die Schlachten um Sebastopol auf der Krim, deren unglaublicher Blutzoll der deutsche General Manstein in seinen Tagebüchern ungerührt schildert, gelten bis heute als Mahnmal einer menschenverachtenden Kriegsführung im Rausch des „Willens zur Macht“. Es gehört zur bitteren Ironie der Geschichte, dass Teile der militanten Kiewer Protestbewegung ausgerechnet auch Nähe zu den Ideen des Nationalsozialismus vorgeworfen wird.
Bei der Beurteilung der politischen Lage in der Ukraine von heute darf man natürlich nicht die unterschiedlichen Interessen und Motive der Beteiligten aus dem Auge verlieren. Wir erleben das junge Nationalbewusstsein der Ukrainer, die verständliche Sehnsucht einer Generation nach würdigen Lebensumständen, die Hoffnung auf die Werte der Demokratie, das verständliche Bedürfnis der Minderheiten nach einer verlässlichen Rechtsordnung, aber auch die Machenschaften der Oligarchen, die strategischen Interessen der global vernetzten Finanzinstitute und die Profitgier der neuen und alten Gläubiger der Ukraine.
Auch heißblütige Nationalisten müssen einsehen, dass die Geschichte der Ukraine ein weiteres Mal nicht nur in Kiew entschieden wird. Es sind nicht zuletzt die internationalen Geldströme, welche die Loyalitäten von Politik und Gesellschaft beeinflussen.
Nicht nur in der Ukraine stellt sich in diesen Tagen die Frage, ob der Griff der Oligarchen nach Medien und die Einflussnahme ausländischer Stiftungen mit ihren Millionenbudgets auf den politischen Prozess überhaupt noch einen fairen Wettbewerb der Meinungen ermöglicht. Der Sturz des alten Regimes wurde nicht zuletzt dadurch ausgelöst, dass ukrainische Oligarchen wie Rinat Ahmetow, dutzenden Abgeordneten, die in ihrem Einflussbereich standen, neue Anweisungen gab. Die aus dem Gefängnis entlassene Julia Timoschenko, eine Hoffnungsträgerin der Opposition, hat als ehemalige „Gasprinzessin“ immer wieder auch gegen den Geruch eigener Korruption anzukämpfen. Es geht schnell unter, dass sie vom IMF, dem „National Endowment for Democracy“ (quasi dem „zivilen“, privatisierten CIA) und etlichen anderen US-Think Tanks über Jahre finanziell gefördert wurde.
Man könnte die politische Lage in der Ukraine nüchtern durchaus so zusammenfassen: „Politiker kommen und gehen, Oligarchen bleiben“. Gerade in der Ukraine muss man sich fragen, ob unsere Kameras, die das politische Geschehen greifbar machen wollen, immer auf die richtige „Bühne“ gerichtet sind. Unser gebannter Blick auf die Tagespolitik in dieser europäischen Schicksalsregion, ist durch eine gewisse Einseitigkeit geprägt, die sich aus unserer alltäglichen Abhängigkeit von der „offiziellen“ Berichterstattung ergibt und letztlich immer wieder nur durch eigene Recherchen vor Ort geprüft werden kann.
Interessant war hier zum Beispiel ein Interview mit der Politikerin Marina Weisband auf SPIEGEL-Online, die das uns präsentierte „Heldenepos“ um den Oppositionsführer Klitschko mit ruhiger Stimme und mit der Souveränität einer Augenzeugin – die wirklich in Kiew vor Ort war – relativierte. „Klitschko wird als Figur kaum ernst genommen. Ich selbst habe niemanden getroffen, der von ihm begeistert war. Er spricht kaum Ukrainisch, sagt bei seinen Auftritten nur wenige Sätze“, liest man im Gespräch mit der „Piratin“ und fügt diesen wichtigen Beitrag sogleich in das eigene Mosaik der gewonnenen Informationen ein. Allerdings relativierte Weisband nach dem Fall der alten Regierung ihre Ablehnung und sah in Klitschko, wahrscheinlich mangels Alternativen, sogar auch einen möglichen Präsidenten. Wer immer Präsident in der Ukraine wird, es wird fragwürdig bleiben, ob er tatsächlich die Macht im Lande hat.
Es war wohl auch dem Verhandlungsgeschick unseres Außenministers, Frank Steinmeier zu verdanken, dass immerhin das fatale Szenario eines Bürgerkrieges zumindest aufgeschoben und – wie wir noch hoffen müssen – auch dauerhaft verbannt wurde. Die Dynamik der Geschichte hatte die Intervention der EU-Delegation flugs überholt. Schnell wurde klar, dass das Ergebnis der „Revolution“ keine souveräne, sondern eine bankrotte Ukraine war. Wer 35 Milliarden benötigt, um zu überleben, kann eben nur begrenzt souveräne Entscheidungen treffen.
Geopolitische Fragen lassen sich genauso wenig verschieben wie fällige Forderungen der Gläubiger. Kann die Ukraine überhaupt ein einheitlicher Staat bleiben?
Diese Frage zu bejahen liegt natürlich auch im Interesse der zwei Millionen Muslime des Landes. Schon im Herbst 2013 hatten in einer gemeinsamen Erklärung alle religiösen Gruppierungen der Ukraine – also Juden, Christen und Muslime – die Unabhängigkeit der Ukraine gefordert und, unter Vorbehalt der Berücksichtigung eigener traditioneller Werte, auch eine Annäherung an die EU befürwortet.
Besonders heikel ist die Lage der Muslime auf der Krim. Siebzig Jahre sind vergangen, seit zehntausende Krimtataren während des Zweiten Weltkrieges durch Stalin verfolgt und deportiert wurden. Heute leben noch etwa 250.000 Muslime in der Region. Verschiedene EU-Organisationen sorgen sich schon seit Jahren um den fragilen Status dieser Minderheit. Auf der Krim herrscht schon länger die Befürchtung, dass die russische Mehrheit – insbesondere bei einer Spaltung der Ukraine oder einer endgültigen „Westbindung“ Kiews – die Ablösung der Halbinsel und später eine Anbindung an Russland durchsetzen könnte. Es ist tatsächlich kaum vorstellbar, dass Russland ihre über Jahrhunderte hart erkämpfte, strategische Position auf der Halbinsel aufgibt.
Die Führung der Krimtataren, eine Minderheit, die 12,1 Prozent der Bevölkerung ausmachen, hat bereits die aktuelle Ankündigung des lokalen Parlaments, wonach ein Regierungswechsel in Kiew die Loslösung der Krim von der Ukraine bedeuten könnte, scharf zurückgewiesen.
Hier besteht zweifellos ungeheures Konfliktpotential, das schon länger mit Sorge beobachtet wird. Es geht letztendlich auch um die grundsätzliche Positionierung Moskaus in seinem Einflussbereich gegenüber dem Islam und den europäischen Muslimen. Natürlich ist das Interesse Russlands an der Verfolgung von Terrorismus und Extremismus legitim, aber durch eine zu beobachtende maßlose Haltung und ausgrenzenden Rigorismus gegenüber den Muslimen könnten sich immer mehr junge Muslime in einen antiquierten Nationalismus oder aber in radikale, fremdbestimmte Ideologien flüchten. Die Auflösung von Traditionen, der Verlust des Wissens durch die Lehre der anerkannten Rechtsschulen – kurzum eine fortschreitende Verrohung der Muslime zu Gunsten einer globalen Ideologie – wäre nicht nur für Moskau, sondern für ganz Europa eine fatale Entwicklung. Darum geht es auch im Umgang mit der muslimischen Minderheit im Süden der Ukraine.
Viel wichtiger wäre es natürlich mit Moskau und dem Land der Dichter und Denker den geistigen Dialog fortzuführen. Der Nationaldichter Tolstoi hat in seinem berühmten Werk über „Krieg und Frieden“ eine der schönsten und tiefsten Abhandlungen in einer europäischen Sprache über das Schicksal verfasst. Ein gutes Schicksal zu erhoffen, gehört zu den wichtigsten Bittgebeten der Muslime. Das furchtbare Beispiel des zerfallenden Jugoslawiens sollte Anlass genug sein, alles zu tun, um eine „Balkanisierung“ der Ukraine zu verhindern.
