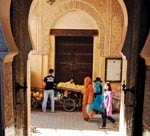(iz). Wie kaum ein anderes Vorhaben stand die Erteilung des Islamischen Religionsunterrichts (IRU) an deutschen Schulen und die einhergehende Einrichtung von Lehrstühlen der – noch im Aufbau befindlichen – „Islamischen Theologie“ im Fokus von Gesprächen zwischen Vertretern deutscher Muslime und staatlicher Einrichtungen. Zweifelsohne wurden darauf viel Aufmerksamkeit und Energie verwandt. Beide Elemente – der Religionsunterricht und die Universitäten zur Ausbildung der Lehrer – sind verbunden. Nachdem die Politik sich mit dem Gedanken eines islamischen Bekenntnisunterrichts durch muslimische Religionsgemeinschaften (ein alter Wunsch deutscher Muslime) angefreundet hatte – die Islamkonferenz sprach sich 2008 dafür aus – ergaben sich Folgefragen. Woher sollten die für den IRU notwendigen Lehrer kommen? Nach einer Schätzung des Bundesbildungsministerium würden mindestens 2.000 Lehrer für die 320.000 muslimischen Schüler benötigt.
Neues Studienfach
Offenkundig ist die Fortführung des Imports ausländischer Imame und Religionslehrer – die seit Jahrzehnten mehrheitlich gewählte Lösung für die muslimischen Gemeinden – nicht im langfristigen Interesse der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland. Verfassungsrechtliche Grundfragen außer Acht lassend, ob bisherige muslimische Organisationen den Anforderungen einer Religionsgemeinschaft entsprechen (im Zusammenhang mit Religionsunterricht nach Art. 7 Abs. 3 Grundgesetz), setzte sich der Vorschlag des Deutschen Wissenschaftsrates zur Einrichtungen von Zentren für eine „Islamische Theologie“ durch. Bis zum heutigen Tage ungeklärt ist die Frage und die konkrete Umsetzung der Beteiligung muslimischer Organisationen beziehungsweise Religionsgemeinschaften. In Folge – und in vergleichsweise hohem Tempo – entstanden fünf Lehreinrichtungen, an denen zukünftige Religionslehrer, Imame und TheologInnen ausgebildet werden sollen.
Die bereits jetzt eingeschriebenen StudentInnen, Graduierten sowie das beteiligte akademische Personal sind so Teil einer sich noch erschaffenden Wissenschaft. Anzumerken sei, dass es in der muslimischen Gemeinschaft bisher wenig Grundsatzdebatten darüber gab, was diese „Theologie“ sein wird, noch in welchem Verhältnis sie zum bisherigen Wissenschaftskanon des Islam stehen wird oder kann. Die neuen Zentren der „Islamischen Theologie“ geben hierauf keine einheitliche Antwort.
Differenzierung
Es wird aber bereits jetzt klar, dass an den fünf Lehranstalten unterschiedliche Schwerpunkte und Perspektiven prägend sein werden. Ein Stichwort hierfür seien neue Konzepte wie “Theologie der Barmherzigkeit“ oder „Theologie der Mitte“. Zusammen mit der jeweils anders gearteten Einbindung muslimischer Organisationen und Repräsentanten dürfte dies zur ihrer weiteren Differenzierung beitragen. Errichtet wurden sie an den Universitäten Tübingen, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt am Main (in Kooperation mit Gießen) sowie Münster und Osnabrück (Beide werden im Verwaltungsrahmen als ein „Standort“ geführt. Es gibt eine Kooperation in Form einer gemeinsamen Jahrestagung und einer gegenseitigen Anrechnung von Studienleistungen). Ungeachtet der akademischen Schwerpunktsetzung dienen sie der Lehre der Islamischen Religionslehre und – mit momentaner Ausnahme von Frankfurt und Tübingen – der „Islamischen Religionspädagogik“. Auf Nachfrage erklärte ein Dozent in einem der Standorte, dass bei ihnen ca. 2/3 aller eingeschriebenen StudentInnen sich für die Theologie eingeschrieben hätten. In Frankfurt gab es eine Stellenausschreibung für eine Professur der „Islamischen Religionspädagogik“. Tübingen will laut Webseite ab Wintersemester 2013/14 einen Lehramtsstudiengang „Islamische Religionslehre“ anbieten. Beide Fächer sind – im Gegensatz zu bisherigen Studiengängen der Islam- oder Religionswissenschaft – bekenntnisorientiert.
Auch wenn alle fünf universitären Standorte unter der Kategorie „Islamische Theologie“ firmieren, entwickeln sie sich bisher doch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Unterschiede bestehen unter anderem bei der Möglichkeit des Studiums zur Religionspädagogik sowie der darin angebotenen Schulformen.
Des Weiteren hängt das Angebot von Lehrveranstaltungen auch von der personellen Besetzung beziehungsweise der Menge der eingeschrieben Studenten im jeweiligen Standort ab. So berichtete „Die WELT“ am 16.10.2012, dass sich nur eine Handvoll StudentInnen am Interdisziplinären Zentrum für Islamische Religionslehre (IZIR) in Erlangen-Nürnberg eingeschrieben hätte. Zu diesem Zeitpunkt waren dort nach Angaben des Blattes auch nur zwei von vier Lehrstühlen besetzt. Zentrumsleiter Harun Behr beispielsweise zielt allerdings auch nicht auf die Masse ab: „Wer die Islamisch-Religiösen Studien absolviert hat, ist ohnehin überqualifiziert für den Imamberuf.“
Derzeit wird jeder Standort mit bis zu vier Millionen Euro jährlich durch Bundesmittel gefördert. Hinzu kommen Stiftungen, die auf diesem Gebiet aktiv sind. Beim Osnabrücker IIT beispielsweise bereiten sich einige Doktoranden auf ihre Promotion mit Hilfe der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) vor. In diese Kategorie fällt auch die Maturidi-Studienförderung für Islamisches Denken, die der türkischen DITIB nahesteht. Das bekannteste Beispiel, die Mercator-Stiftung, ihrerseits ist seit der Einführung der „Islamischen Theologie“ mit einem standortübergreifenden Programm im Rahmen ihres Graduiertenkollegs vertreten. Ihre Stipendiaten arbeiten und forschen an den jeweiligen Standorten. Außerdem gibt es eine Kooperation bei der Organisation von Tagungen, Veranstaltungen und Studienreisen. Koordiniert wird dieses Programm von Münster aus. Die Auswahl der Nachwuchswissenschaftler nehmen die Professoren der Standorte zusammen mit einigen Professoren der Islamwissenschaft vor. Da die Graduierten auch als wissenschaftliche Mitarbeiter beziehungsweise Dozenten an der jeweiligen Fakultät eingebunden sind, gestalten sie das Profil ihrer lokalen Lehreinrichtung mit. Zum standortübergreifenden Studienprogramm des Kollegs werden regelmäßig internationale Gastwissenschaftler eingeladen.
Ungeklärte Beteiligung
Noch stellenweise unterschiedlich gehandhabt beziehungsweise auch unklar ist die Einbindung muslimischer Gemeinschaften (in ihrer bisherigen Form als Moscheenorganisationen und Dachverbände) in die Gestaltung der Lehrinhalte von „Islamischer Theologie“ und „Islamischer Religionspädagogik“. „Über die Lehrinhalte (und auch Professuren) bestimmen die Verbände aber nur insofern, dass sie ein Veto einlegen dürfen, wenn konkrete Inhalte/Personen gegen religiöse Grundsätze verstoßen. Die Lehrpläne und Einstellung der Professuren obliegen aber ausschließlich den Universitäten“, meinte ein Insider auf Anfrage der IZ. Insbesondere beim Religionsunterricht ist dies nach Meinung muslimischer Vertreter relevant, weil die Vorgaben des Grundgesetzes („Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“ Art. 7 Abs. 3) natürlich die Beteiligung einer Religionsgemeinschaft vorsähen. Als Beispiel hierfür mag der nordrhein-westfälische Beirat für den Islamischen Religionsunterricht gelten. „Verfassungsrechtlich ist jedoch klar, dass die Entscheidungen zu den inhaltlichen Fragen der Theologien grundsätzlich nur den Religionsgemeinschaften zustehen. Diese gewährleisten durch ihre Mitwirkung, dass das jeweilige Bekenntnis zur Geltung kommt, sind Garant für die Authenzität der Theologie und gewährleisten die Rückkopplung mit der muslimischen Basis in den Moscheegemeinden“, schrieb Engin Karahan vor einigen Wochen. Er ist Referent für Rechtsfragen im Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland.
Karahan und andere verweisen darauf, dass an einigen Standorten diese Mitwirkung muslimischer Religionsgemeinschaften (die bisher keinen Status im Sinne einer Körperschaft des öffentlichen Rechts inne haben) zwar vorgesehen sei, „jedoch nur in einer abgestuften Version“ gehandhabt werde. Das liege unter anderem daran, da das Modell des Wissenschaftsrates aus dem Jahre 2010 auch „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ als Beiratsmitglieder einschließt.
Umgesetzt wird dieses Modell (ähnlich zur Zusammensetzung der Deutschen Islamkonferenz) nur stellenweise an den Standorten Münster und Tübingen, da es hier nur eine begrenzte Beteiligung muslimischer Gemeinschaften gibt. In Tübingen gibt es einen Beirat muslimischer Vertreter, aber nur zwei kommen aus dem organisierten Islam – ein Vertreter der DITIB sowie der bosniakischen IGBD. In Fall Münster kommt hinzu, dass man bisher auf die konstituierende Sitzung des Beirates wartet. In Erlangen-Nürnberg habe man, so Karahan, die Zusammenarbeit mit organisierten Muslimen bisher verweigert. „Das Zentrum rühmt sich sogar öffentlich damit, die muslimischen Religionsgemeinschaften nicht zu berücksichtigen.“ Dort hat man einen Beirat aus 16 Einzelpersonen gebildet, und die Gemeinschaften umgangen.
Wegen seines Ursprunges als Stiftungsprofessur der staatlich-türkischen Diyanet hat sich in Frankfurt kein Beirat konstituiert. Nicht nur Engin Karahan ist der Ansicht, dass es bisher einzig der Standort Osnabrück sei, „der für eine verfassungsrechtlich saubere Gestaltung der Mitwirkung der muslimischen Religionsgemeinschaften gesorgt hat. Dem dortigen Beirat gehören nur Vertreter der muslimischen Gemeinschaften an“.
Offene Fragen
Nicht nur, weil es bisher innerhalb der muslimischen Gemeinschaft an einer inhaltlichen und terminologischen Auseinandersetzung mit dieser akademischen Neuschöpfung fehlte, bleiben Fragen offen. Wie Hermann Horstkotte in der „Süddeutschen Zeitung“ berichtete, wurde ein Kandidat für den Münsteraner Beirat von Universitätsleitung und Bundesministerium abgelehnt. Es wurde gar mit Einstellung der Finanzmittel gedroht. Pikant daran ist, dass der abgelehnte Repräsentant problemlos Mitglied des NRW-Beirates für den Islamischen Religionsunterrichtes ist.
Muslime in Deutschland stellen sich nicht nur deswegen die Frage, inwieweit sie uneingeschränkten Zugang zu einer freien Lehre haben, wie sie bei den großen christlichen Konfessionen Usus ist.