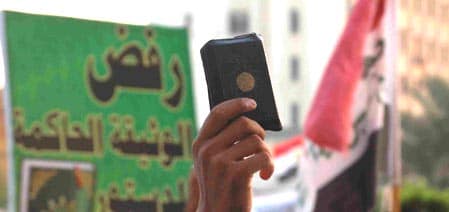(iz). Wie ist die Lage der deutschen Muslime? Bisher waren es vor allem Beobachter von Außen, die dazu – mehr oder weniger qualifizierte – Aussagen treffen. Im April erscheint im Herder Verlag „Neo-Moslems. Porträt einer deutschen Generation“. Darin versucht der junge Autor Eren Güvercin, neue und nach vorne weisende Antworten auf offene Fragen zu geben. Ihm geht es insbesondere um selbstbewusste Ansätze, mit denen sich die junge Generation der Muslime konstruktiv und überraschend zu Wort meldet.
Eren Güvercin, geboren 1980 als Sohn türkischer Eltern in Köln, studierte Rechtswissenschaften in Bonn und arbeitet als freier Journalist für verschiedene Hörfunksender und Zeitungen. Er ist Mitinitiator der „Alternativen Islamkonferenz“ und betreibt das Blog erenguevercin.wordpress.com.
Islamische Zeitung: Im April erscheint dein erstes Buch bei Herder („Neo-Moslems. Porträt einer deutschen Generation“). Wer sind diese Neo-Moslems? Musste man für sie extra ein neues Wort erfinden?
Eren Güvercin: Ich bin kein Freund davon, dass man für die Muslime in Deutschland neue Worte erfindet. Im Laufe der Entwicklung des Buches sind wir in der Kooperation mit meinem Lektor auf die „Neo-Muslime“ gestoßen. Er fand den Titel griffig und beim zweiten Nachdenken dachte ich, dass es für den Leser auf jeden Fall spannend sein würde.
Bei „Neo-Muslimen“ mag man im ersten Augenblick an Neonazis oder Neoliberalismus denken. Also Begriffe, die negativ besetzt sind. Es vermittelt aber auch etwas, das neu und frisch ist und sich daher für den Titel eignet. Man muss auch die Seite der Vermarktung im Auge behalten, damit potenzielle Käufer angezogen werden. Daher fand ich diesen Titel gut.
Wer die Neo-Muslime sind… (überlegt)… Das sind junge Muslime wie ich, die einen türkischen oder arabischen Hintergrund haben, aber hier geboren und aufgewachsen sind. Sie sind ein ganz natürlicher Bestandteil der deutschen Gesellschaft wie alle anderen auch. Als Neo-Muslime kann man ebenso die größer werdende Anzahl deutscher Muslime sehen, die – aus welchen Gründen auch immer – zum Islam gefunden haben.
Islamische Zeitung: Du hast dich, auch in der IZ, Mitte letzten Jahres an der Liberalismus-Debatte beteiligt. Dabei wendest du dich auch gegen die Etikettierung von Muslimen. Ist das nicht ein Widerspruch zu der Vorstellung von „Neo-Muslimen“?
Eren Güvercin: Meine Kritik richtete sich an alle Seiten, da mit dem Label „konservativ“ oder „liberal“ Muslime etikettiert werden. Den Vorgang habe ich generell kritisiert; unabhängig davon, wie ich zu „konservativen“ oder „liberalen“ Inhalten stehe. Interessanterweise wurde meine Kritik nur von den Repräsentanten eines so genannten „liberalen Islams“ zurückgewiesen. Es gab natürlich auch Gegenstimmen, und diese werden sich jetzt sicherlich auf das Wort „Neo-Muslime“ stürzen und sagen: „Herr Güvercin, sie betreiben ja gleichfalls dieses Labeling!“ Da muss man sich aber erst einmal das Buch anschauen und dann bin ich auch für diese Kritik offen. Wenn man das Buch liest, wird klar, dass das keine Etikettierung ist, sondern nur ein Buchtitel. Schließlich urteilen wir über ein Buch ja nicht über den Titel, sondern über den Inhalt.
Islamische Zeitung: In Zeiten des Niedergangs denken Menschen oft mehr darüber nach, was sie sind, als was sie tun – Stichwort „Identitäts-Debatte“. Sind die Neo-Muslime da anders, oder leiden sie an ihrer Identität? Haben sie multiple Identitäten?
Eren Güvercin: Multiple Identitäten? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, sind dies Begriffe, die mir nicht viel sagen. Um es einfach zu machen: Ich als junger Muslim, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, finde diese ganzen Identitätsdebatten, wonach wir zwischen zwei Kulturen stünden etc., relativ nutzlos und öde. Sie haben mich nie interessiert. Ich pfeife drauf.
Sie stehen auch nicht im Zentrum meines Buches. Ich versuche, in separaten Themenbereichen Debattenbeiträge zu leisten, bei denen man zu Anfang nicht gedacht hätte, dass hier Muslime etwas zu sagen hätten. Diese ganze Identitätsdebatte läuft schon seit 10 bis 20 Jahren. Wenn es so weitergeht, wird auch in den kommenden 20 Jahren um Identität, Integration und Kulturkampf und was auch immer gestritten. Ich finde die Vorstellung, dass wir armen deutsch-türkischen Muslime zwischen Stühlen sitzen würden, offen gestanden recht langweilig. Das ist auch nicht mein Thema.
Ich denke, wir sollten als Muslime einmal selbstkritisch fragen, ob wir zu allen Themen, die in Medien debattiert werden, etwas sagen müssen. Wir sollten vielleicht auch souverän genug sein und entgegnen, dass Identitätskonflikte nicht unser Thema sind. Ich persönlich will dazu keinen Beitrag leisten. Selbst in meiner Jugend war dies nie ein Thema für mich. „Bin ich ein Türke? Bin ich ein Deutscher?“ Das hat mich nie wirklich interessiert.
Islamische Zeitung: Es gibt viele neue Projekte – innerhalb wie außerhalb der bestehenden Strukturen – dieser neuen Generation. Ist sie für dich der Motor von Veränderung?
Eren Güvercin: (überlegt)… Es gibt natürlich gerade unter den jungen Muslimen viele verschiedene Initiativen. Seien es die Zahnräder, Internet-Communities, Cube-Mag etc. Ich finde es grundsätzlich positiv, dass Jugendliche aus verschiedenen Hintergründen, Vereinen und Verbänden zusammenkommen und etwas gemeinsam machen. Aber diese Projekte haben mich offen gestanden nie so angesprochen, dass ich 100-prozentig dahinter stehen würde.
Die meisten beschäftigen sich immer mit den selben Dingen. Oft handelt es sich dabei um eine Reaktion auf Debatten, die uns von der Gesellschaft vorgesetzt werden. Es ist selten der Fall, dass junge Muslime eigene Themen setzen und auch einmal das Bild der Muslime in Deutschland brechen. Die Generation unserer Eltern konnte das nicht, weil sie aus einem ganz anderen Milieu kam und einen anderen Erfahrungshorizont hatte. Meine Eltern sind damals Ende der 1960er Jahre aus einem anatolischen Dorf direkt nach Deutschland gekommen. Sie hatten keinerlei Sprachkenntnisse, haben aber das Beste aus ihrer Situation gemacht. Sie haben alles für uns getan. Selbst wenn meine Mutter eine Analphabetin ist, hat sie darum gekämpft, dass ihre Kinder die beste Bildung bekommen.
Es liegt jetzt an uns, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und voranzukommen und auch von uns aus der Gesellschaft etwas anzubieten. Ich finde, dass viele junge Muslime auf ihre Situation nur reagieren, als dass sie agieren würden und aus einer Position der Stärke vielleicht auch zu anderen als den medial inszenierten Themen Stellung beziehen würden.
Islamische Zeitung: Aus welchen Gründen auch immer haben wir einen Dschungel multipler Identitäten und Lebensentwürfe – auch unter den Muslimen. Sie sind – anders als die so genannten liberalen Kritiker – keine homogene Masse. Wie lassen sich für die Muslime im Dschungel dieser Meinungen verbindliche Positionen formulieren? Können wir verhindern, dass das ganze in Bedeutungslosigkeit abgleitet?
Eren Güvercin: Egal, welcher Strömung man angehört, gibt es immer viele gemeinsame Nenner. Entscheidend ist, dass man nicht nur zwischen Gleichgesinnten in seinem eigenen Ghetto lebt. Wir müssen aus unserem eigenen Milieu heraustreten und uns mit anderen Muslimen treffen. Ungeachtet der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verband oder zu einer spezifischen Initiative lassen sich immer verbindliche Elemente finden.
Betrachten wir die Debatte der letzten Monate zwischen so genannten „konservativen“ und „liberalen“ Muslimen. Würden sich die Vertreter beider Positionen wirklich begegnen, ließen sich Punkte formulieren, die sich als gemeinsame Ansichten herauskristallisieren.
Ich halte nichts von diesen künstlichen Gräben – seien es die zwischen verbandsgebundenen und ungebundenen Muslimen. Obwohl ich selbst nie Mitglied gewesen bin und die Verbände mich persönlich auch nicht ansprechen, sehe ich bei der Begegnung mit Mitgliedern von Milli Görüs oder anderen großen Verbänden schon, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Selbst die Mitglieder eines bestimmten Verbandes sind in sich überhaupt keine homogene Masse. Es wäre beispielsweise bei der Milli Görüs unfair zu behaupten, alle ihre Mitglieder seien konservativ oder sonst was. Selbst innerhalb der „liberalen“ Muslime wird man solche finden, die teilweise konservative Ansichten haben. Die Welt ist nicht so schwarz-weiß, wie wir sie uns gerne zeichnen würden. Daher ist die inflationäre Verwendung der Labels „konservativ“ und „liberal“, um sich von den jeweilig anderen abzugrenzen, eine reine Kampfrhetorik. Inhaltlich steckt da kaum was dahinter.
Islamische Zeitung: Braucht es dafür nicht Pole der Autorität, die in dieser Vielfalt Prioritäten setzen? Oft werden die unwichtigsten Fragen – wie das Binden des Kopftuchs – auf die gleiche Stufe mit den wichtigsten – wie der Zakat – gestellt. Man gewinnt den Eindruck, dass das vertikale Wissens des Islam durch die neuen Organisationsformen nivelliert wird.
Eren Güvercin: In der islamischen Geschichte übernahmen diese Funktionen immer die Gelehrten. Viele jungen Muslime beschäftigen sich mit ihrem Din. Kommt es dann zu Fragen, ist das Internet die erste Instanz, der sie sich zuwenden. Zuerst wird einmal „Schaikh Google“ konsultiert, anstatt zuerst zu einem Imam des Vertrauens zu gehen. Daher ist es umso wichtiger in unserer Zeit, dass die dafür ausgebildeten Personen mit solchen Fragen konfrontiert werden.
Niemand kann behaupten, dass alle Imame in Deutschland des Deutschen nicht mächtig wären oder in einer Parallelgesellschaft lebten. Es gibt genau so viele Imame, die wissen, wie das Leben in Deutschland ist und die die Probleme der Jugendlichen kennen. Man sollte sie aber auch ansprechen.
Islamische Zeitung: Nach mehr als einem Jahrzehnt Internet, soziale Netzwerke und digitaler Endgeräte; haben sich die traditionellen Formen und Denkregeln irreversibel geändert – Stichwort „Schaikh Google“ – oder finden die jungen Muslime einfach nicht die passenden Imame, denen sie sich zuwenden können?
Eren Güvercin: Natürlich gibt es dieses Problem, aber es gibt gleichermaßen immer mehr junge Muslime, die sich von den traditionellen Gemeinden distanzieren. Sie bauen eigene, quasi gemeinschaftliche Strukturen auf. Natürlich kann man auf das Wochenendtreffen einer Jugendorganisation gehen und dort ein schönes Wochenende haben. Aber eine Moschee vor Ort, wo man zumindest zum Freitagsgebet hingeht und eine gemeinschaftliche Realität hat, ist eine andere Sache. Das ist ein Punkt, der definitiv unter jungen Muslimen thematisiert werden sollte.
Das ist halt Fluch und Segen der Technik. Ich will nicht alles verteufeln, aber Muslimen sollte bewusst sein, dass – egal, welche Technik das ist – es auch einen Einfluss auf ihren Alltag hat. Es braucht hier eine kritische Distanz, oder besser gesagt einen gelasseneren Umgang mit der Technik.
Islamische Zeitung: Glaubst Du, dass einer deiner archetypischen Neo-Muslime, deren muslimische Identität nicht unerheblich durch Twitter, Facebook und das Internet geprägt wird, überhaupt noch in der Lage ist, so etwas wie die traditionelle Wissensaneignung zu verstehen?
Eren Güvercin: Das Problem ist, dass sie es nicht kennen. Würden sie es kennenlernen, würden sie es definitiv schätzen. Ich glaube, sie versuchen sich aus dieser Unkenntnis heraus im Internet eine alternative Sicht zu suchen. Ich habe einen Zugang dazu, aber viele andere im meinem Umfeld haben es nicht. Könnten sie den qualitativen Unterschied erkennen, würden sie verstehen, dass das Internet kein authentisches Wissen bietet, sondern bloße Information. Die direkte Wissensvermittlung ist etwas ganz anderes als die bloße Vermittlung von Information über das Internet etwa.
Die großen muslimischen Organisationen, welche die Ressourcen dazu haben, sind in der Verantwortung, die muslimischen Jugendlichen auch mit diesem Wissen in Verbindung zu bringen. Wenn sie nicht dazu in der Lage sind, haben sie versagt.
Islamische Zeitung: Gelegentlich hat man das Gefühl, dass allen neuen Ansätze – von den „liberalen Muslimen“ bis zu den „Neo-Salafiten“ – die Herzenswärme und der Stallgeruch der alten Hadschis fehlt, die noch eine innere Verbindung zum Propheten und zu Medina haben. Das ganze wirkt manchmal etwas steril. Teilst du diese Erfahrung und brauchen wir dazu nicht ironischerweise „alte“ Elemente wie die Futuwwa?
Eren Güvercin: Im ersten Kapitel meines Buches würdige ich die erste Generation meiner Eltern, die hier alles aufgebaut hat. Ich habe sie als die „goldene Generation“ bezeichnet – ganz besonders die Frauen. Sie haben ganz viel geleistet. Gerade durch die einfache Spiritualität der anatolischen Bauern haben sie uns ganz viel vermittelt. Das können nur die wissen, die das auch erfahren haben. Was uns meine Eltern an Spiritualität gegeben haben, findet man an keiner Universität, auf keinem Wochenendtreffen, in keinem Iman-Seminar oder sonst irgendwo. Ich glaube, dass wir als junge Muslime, die in Deutschland geboren wurden, glauben: „Wir sind fortschrittlich und haben in Europa eine gute Bildung genossen.“ Ich denke, dass wir langsam merken, was wir an unseren alten Leuten haben. Es ist genau diese Herzenswärme, die sie uns in den Hinterhofmoscheen vermittelt haben. Heute haben wir neue, repräsentative Moscheebauten, aber wenn die Spiritualität fehlt, dann nutzt auch das schönste Gebäude nichts. Es waren Menschen, die nicht viel zu reden brauchten, um echtes Wissen zu vermitteln. Auch in der gesellschaftlichen Debatte kommt die Wertschätzung der ganzen Gastarbeiter-Generation viel zu kurz.
Islamische Zeitung: Nehmen wir dein Buch als Ausgangsbasis; was wäre die Quintessenz, aus der man neue Sachen entwickeln könnte?
Eren Güvercin: Gegen Ende gehe ich auf meine Idee einer alternativen Islamkonferenz ein. Für manche mag das eine Provokation sein, weil man glauben könnte, dass es sich dabei um ein Konkurrenzprodukt zur DIK handelt. Die ihr zugrunde liegende Idee ist, dass bei einer wirklichen innermuslimischen Begegnung auf Augenhöhe womöglich vorher da gewesene Differenzen sich erfahrungsgemäß von selbst auflösen werden. Ich versuche mit Unterstützung von Feridun Zaimoglu, alle relevanten Muslime zusammenzubringen – konservativ oder liberal, organisiert oder unorganisiert. Wir sollten miteinander, statt übereinander reden. Es geht nicht um die Gründung einer Über-Organisation, sondern das einzige Ziel ist, dass sich die verschiedenen Muslime begegnen, sich austauschen und meinetwegen auch sich streiten. Das ist bisher niemals der Fall gewesen. Bisher kamen die Muslime nur auf Einladung seitens Dritter zusammen, wo es aber niemals ein Gespräch auf Augenhöhe gab.
Islamische Zeitung: Das scheint ja einer der Punkte zu sein, an dem du dich mit Lamya Kaddor triffst, die im letzten Monat einen „Muslimtag“ vorschlug…
Eren Güvercin: Die Idee stammt ja von Abdul-Ahmad Rashid, dem ZDF-Redakteur vom „Forum am Freitag“, den ich sehr schätze. Ich finde den Vorschlag auch gut, nur handelt es sich dabei um etwas anderes. Seine Idee ist die Organisation eines öffentlichen Events nach dem Vorbild des Kirchentags.
Ich finde solch ein Vorhaben wichtig und würde so etwas auch sofort unterstützen. Es geht mir bei der Alternativen Islamkonferenz aber um eine Debatte unter den Muslimen, bei der über alles gesprochen werden kann – meiner Meinung auch gerne hitzig. Um diese Offenheit zu gewährleisten, braucht es einen geschützten Raum. Es muss auch Zonen geben, in denen die Muslime untereinander sein können. Dialogveranstaltungen haben wir meiner Meinung nach genug gehabt in den letzten Jahren. Warum soll es nicht auch einmal einen wirklichen Dialog unter Muslimen geben?
Islamische Zeitung: Lieber Eren, vielen Dank für das Gespräch.