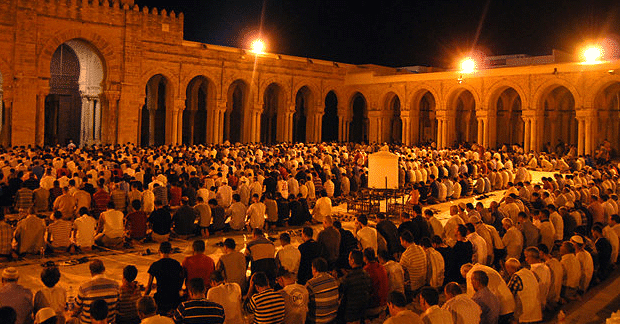Narendra Modi ist in Indien ein Politikstar – und wahrscheinlich der nächste Premierminister. Er vermarktet sich als Macher, der die Wirtschaft in seinem Bundesstaat Gujarat zum Blühen bringt. Von der Ausgrenzung der Muslime und Armut dort spricht er nicht.
Neu Delhi (dpa). «Entwicklung» ist eines der Lieblingswörter von Narendra Modi. «Wandel» ein anderes. Und auch «Investitionen». Der 63-Jährige greift gerade nach dem wichtigsten Amt in Indien und möchte das Milliardenland tatkräftig umkrempeln: Straßen und Stromleitungen bauen, Geld aus dem Ausland anlocken, die grassierende Korruption eindämmen, dringend benötigte Jobs schaffen.
Wenn Modis Partei BJP – wie alle Prognosen voraussagen – am Freitag die Mehrheit im indischen Unterhaus bekommt, kann er loslegen. Dann, so lautet die Hochrechnung von Modi, werde der ganze Subkontinent so aufblühen wie der Bundesstaat Gujarat, den er seit zwölf Jahren regiert. Doch umfasst das «Gujarat-Modell» nicht nur Fabriken und Hochhäuser. Es steht auch für zerstörte Umwelt, protestierende Bauern und eine tiefe Spaltung der Gesellschaft.
In Ahmedabad, der größten Stadt Gujarats, lebt die muslimische Minderheit in strikt abgegrenzten Ghettos. Allein im Viertel Juhapura wohnt fast eine halbe Million Menschen, im Norden von den Hindus durch eine kilometerlange, mit Stacheldraht besetzte Mauer getrennt. Direkt an der «Grenze» lebt Imam Khan. Doch sicher fühlt er sich deswegen nicht. «Es gibt keinen Schutz für Muslime in diesem Land», sagt er.
Die Mauer wurde vor mehr als 20 Jahren gebaut. Denn 1992 gab es blutige Kämpfe zwischen Hindus und Muslimen. Mal wieder. Schon bei den großen Massakern 1969 und 1985 wurden in Gujarat jeweils Hunderte Menschen ermordet, und auch davor, zwischendrin und danach flammte die Gewalt immer wieder auf. «In keinem anderen indischen Bundesstaat starben in den vergangenen Jahrzehnten mehr Menschen durch religiöse Unruhen», sagt die Soziologin Raheel Dhattiwala. Dabei wurde Mahatma Gandhi, die Ikone der Gewaltlosigkeit, in Gujarat geboren.
Imam Khan lebt seit 40 Jahren an dem Ort, den die Hindus in Ahmedabad heute abfällig «Klein Pakistan» nennen. Damals, erzählt er, habe die Gegend rund um sein Haus nur aus Feldern und kleinen Dörfern bestanden. Zu Fuß sei er, der Muslim, zu den Hindus hinüber gelaufen. «Ich war sogar ein Treuhänder ihres kleinen Tempels», sagt er. Heute lebten sie in zwei verschiedenen Welten. Das gilt auch für die Infrastruktur: Die Leitungen für Wasser, Abwasser und Gas enden an der Mauer. «Auf dieser Seite haben wir nichts.»
Seine schlimmsten Erinnerungen stammten aus dem Jahr 2002, kurz nachdem Modi die Regierungsgeschäfte in Gujarat übernahm, sagt Khan. Damals wurden hinter der Mauer gerade moderne, mehrstöckige Gebäudekomplexe gebaut, die heute weit über sein Haus emporragen. «Von den Rohbauten aus attackierten sie uns. Mit Säure-Bällen, Benzin-Bomben und Steinen. Wir trauten uns kaum aus dem Haus, nachts konnten wir kein Licht machen. Monatelang ging das so.»
Die Unruhen von 2002 tobten nicht nur in Juhapura, sondern an Hunderten Orten in Gujarat. Mehr als 1000 Menschen wurden getötet, die meisten davon Muslime, Mobs raubten ganze Viertel aus, mehr als 100 000 Menschen mussten in Lager fliehen. Soziologin Dhattiwala, die ihre Doktorarbeit zu den Unruhen verfasste, nennt sie «Pogrome». «Weil sie nicht spontan waren, sondern vom Staat gelenkt wurden.» Modis hindu-nationalistische BJP profitierte von dem Hass: Seit 2002 gewann sie alle Wahlen in Gujarat mit absoluter Mehrheit.
Naroda Patiya war eines der am schlimmsten betroffenen Viertel. «Ein Mob von 5000 Menschen sammelte sich am Highway 8, vor der alten Moschee. Sie riefen: „Tötet sie alle, verbrennt sie bei lebendigem Leib“», erinnert sich Master Nazir, der örtliche Lehrer. Dann seien sie, mit Macheten und Benzinkanistern in den Händen, auf das Viertel zugestürmt – angestachelt von Politikern, angeführt von Polizisten.
«Einer schlitzte einer schwangeren Frau den Bauch auf. Er spießte das Baby auf und hielt es triumphierend in die Luft», erzählt Nazir weiter. «Eine 75 Jahre alte Frau wurde von ihrer Terrasse geschmissen, dann ihr Körper auf eine Rikscha geworfen und dort verbrannt. Junge Frauen wurden auf offener Straße vergewaltigt.» 101 Menschen seinen gestorben, darunter ein guter Freund von ihm, der eine Polizeikugel abbekam.
«Eine solche Tragödie kann man nicht einfach vergessen», sagt er. Trotzdem hat Nazir keine Rachegelüste. Die 50 Hindus, die schon vor dem schrecklichen 28. Februar 2002 in Naroda Patiya lebten, wohnen noch immer im Viertel – ganz anders als in zahlreichen Hindu-Gegenden, in denen selbst reiche Muslime keine Wohnung bekommen. Die Hindu-Kinder gingen auf seine Schule, sagt Nazir.
Gegenüber der Schule, neben den Ziegen und Hühnern, die im Schatten der einfachen Häuser leben, steht eine kleine Fabrik. Dort stellen muslimische Arbeiter die heiligen Fäden her, die Priester den Hindus im Tempel ums Handgelenk binden. «Unser Erkennungszeichen als Menschen ist nicht die Religion, es ist das Blut. Und das ist bei uns allen rot», sagt Nazir.
Überall in Ahmedabad erheben Muslime die Forderung, die Regierung solle den Austausch zwischen den Religionen fördern. Und endlich die zugesagten Entschädigungsgelder für die Opfer der Gewalt zahlen. «Aber Modi kümmerte sich nie um uns», sagt Nazir. Im ganzen Umkreis gebe es keine Schule und kein Krankenhaus, und die meisten Straßen sind nicht geteert. «Was hat Modi denn bitte für die normalen Menschen getan, obwohl er immer von seinem „Gujarat-Modell“ spricht?»
Dieses Modell bedeutet meist zweistelliges Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren, während Gesamt-Indien zuletzt auf unter fünf Prozent einbrach. Es steht für schnelle Genehmigungen statt jahrelanger bürokratischer Hürdenläufe. Für klare Regeln statt Korruption. Und vor allem für offene Türen für Investoren.
Eine besonders beliebte Geschichte geht so: Der indische Autohersteller Tata Motors stieß beim Bau seiner Nano-Fabrik in Westbengalen auf enorme Proteste. Die Bauern wehrten sich mit Händen und Füßen, ihr Land für die Fabrik herzugeben. Schließlich machte Tata einen Rückzieher. Nur wenige Stunden später erhielt Ratan Tata, der damalige Chef der Tata-Gruppe, eine SMS von Modi: «Willkommen in Gujarat». Nach wenigen Tagen war der Land-Deal vollzogen. Und Ford, Peugeot und Maruti Suzuki folgten bald.
«Modi ist überzeugt davon, dass alle Menschen davon profitieren, wenn die Wirtschaft brummt», sagt Yamal Vyas, Sprecher der BJP in Gujarat. Um dieses Unternehmertum zu fördern, habe er für eine ununterbrochene Stromversorgung und gute Straßen gesorgt. Auch die Verwaltung funktioniere tadellos, weil Modi so fokussiert arbeite und anleite. «Er sagt niemals „vielleicht“, sondern immer „ja“ oder „nein“.»
Analysten jedoch meinen, dass diese große persönliche Kontrolle auch Probleme mit sich bringe. Niemand traue sich mehr, Projekte zu kritisieren, auch wenn sie totaler Blödsinn seien, meint etwa Rajiv Shah vom Zentrum für soziale Gerechtigkeit. So sollte etwa die «intelligente Stadt» Dholera entstehen, eine Metropole, doppelt so groß wie Mumbai, voller glänzender Hochhäuser, die an Shanghai oder Singapur erinnern. «Doch bis heute ist das nur karges Land, es gibt kaum Investoren», sagt er.
Auch GIFT, die «Gujarat Internationale Finanz-Technologie-Stadt», besteht bislang nur aus zwei Häusern – die auch noch zum Großteil leer stehen. «Welches große Finanzinstitut will denn seine Büros nach Gujarat bringen?», fragt Shah. Der Modi-Vertraute Jay Narayan Vyas hingegen meint, die Planung sei gut gewesen, Investoren hätten kommen wollen, nur habe ihnen die weltweite Finanzkrise dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wie so oft in Gujarat gibt es eben viele Antworten auf eine Frage. Schulbildung? 99 Prozent beginnen in der Grundschule, aber besonders viele Kinder scheiden nach nur wenigen Jahren aus. Unterernährung bei Kindern? Liegt bei 41 Prozent, und damit über dem Durchschnitt in Indien, doch gibt es in Gujarat eben auch schwer zu erreichende Stammesvölker, Wüstendörfer und arme Küstenbewohner. Florierende Wirtschaft? Ist Modis Steckenpferd, war aber schon in den Jahrzehnten zuvor ziemlich ausgeprägt.
«Modi gibt Tonnen an Geld aus, um die Entwicklung Gujarats als seinen persönlichen Erfolg zu preisen», sagt der lokale Journalist R.K. Mishra. Modi rede immer von Fortschritt, aber dabei polarisiere er das Land. Unter dem wilden Fabrikwachstum litten die Bauern, denen Land weggenommen würde, sowie die Umwelt, auf die niemand mehr Rücksicht nehme. «Doch Modi ist wie ein Magier, er kann es dennoch allen verkaufen.»
Während des Wahlkampfes sagte Modi in der heiligen Stadt Varanasi: Wenn ihr mich wählt, werde ich den Ganges so saubermachen wie den Fluss Sabarmati in Gujarat. Wer jedoch an dessen Ufer steht, auf einer bombastischen Betonpromenade in Ahmedabad, sieht eine braune, stinkende Brühe. Der Sabarmati, das zeigen Daten der Zentralen Umweltschutzbehörde, gehört zu den dreckigsten Flüssen Indiens.