
Rassismus gegen schwarze Menschen ist beileibe nicht nur auf die weiße Mehrheitsgesellschaft beschränkt. Suraj Mailitafi berichtet bei PressF von seinen Erfahrungen.
(iz). Muslime – ob Gelehrte oder nicht – betonen zu Recht, dass Allah, Sein Gesandter und Sein Din viele Argumente gegen Rassismus liefern. Und dass kein Gläubiger, alleine schon wegen unserer gemeinsamen Abstammung von Adam, Anspruch auf irgendeinen „rassischen“ Vorrang erheben kann.
Der US-amerikanische Gelehrte und beliebte Imam Schaikh Zaid Shakir sieht diese Ideologie und ihre Praxis als zentrales moralisches Problem, das im Widerspruch zu Allahs Din steht. Er betont, dass Rassismus im Islam nicht nur verboten, sondern theologisch mit der Haltung Satans identisch sei, der sich über Adam erhob, weil er sich aus „besserem Stoff“ erschaffen glaubte.
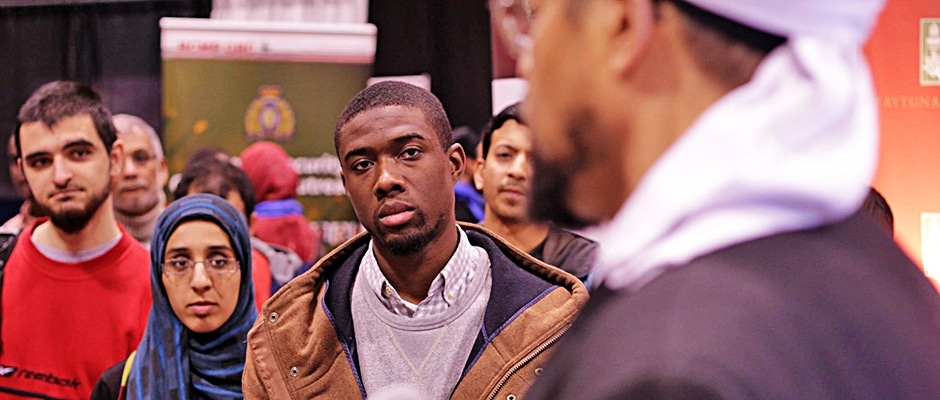
Foto: Archiv
Unser Herr habe die Verschiedenheit der Hautfarben als Zeichen Seiner Größe geschaffen, nicht zur Hierarchie. Der Schaikh erinnert bspw. in einem Interview daran, dass der Prophet Muhammad schwarze Gefährten wie Bilal ibn Rabah in hohe Positionen erhob und so soziale Barrieren aufbrach.
Er ruft Muslime in den USA dazu auf, Rassismus in eigenen Gemeinden offen anzusprechen statt mit Phrasen wie „Wir sind eine Umma“ zu verdrängen. Schwarze, so Shakir, litten noch immer unter subtiler und institutioneller Diskriminierung.
Islamische Ethik verlange, Machtverhältnisse zu reflektieren, Privilegien abzubauen und Solidarität aktiv zu leben – nicht nur in Worten, sondern in religiösem und sozialem Handeln.
Auch in Deutschland leiten manche Muslime – aus verschiedenen ethnischen Milieus – aus diesem Imperativ und Gebot des Antirassismus ab, dass sie deshalb keine Rassisten sein können, weil „der Islam“ das ja verbiete.
Die Realität sieht bei uns – ähnlich wie in den USA – anders aus. Schwarze Geschwister berichten von Diskriminierungen in manchen Gemeinschaften. Und insbesondere bei der Heiratssuche wird ihnen von eingewanderten Eltern nicht selten die Zustimmung verweigert.
PressF, ein Medien- und Kommunikationsprojekt der Nürnberger Bildungseinrichtung Tugendclub, hat vor Kurzem ein langes Hintergrundgespräch mit dem Aktivisten und Content Creator Suraj Mailitafi über antischwarzen Rassismus geführt – in der Mehrheitsgesellschaft wie unter MuslimInnen. Er beschreibt eindrücklich, dass es kein Randphänomen ist, vielmehr tief in Strukturen verwurzelt.
Er betont, dass die Mehrheit der Gesellschaft so sozialisiert sei – nicht zwangsläufig aus bewusster Feindseligkeit, eher weil rassistische Denkmuster und Narrative historisch, kulturell und institutionell weitergegeben werden. Rassismus beginne nicht mit Hass, sondern mit unbewussten Vorurteilen, die in Schule, Medien, Politik und Alltag fortbestehen.

Foto: Denisha DeLane, Shutterstock
Der aus Ghana stammende Aktivist und Naturwissenschaftler kritisiert die deutsche Neigung, Rassismus als überwunden zu betrachten. Viele Weiße reagierten defensiv, sobald sie auf rassistische Strukturen hingewiesen werden. Aussagen wie „Ich sehe keine Farben“ hält er für problematisch, weil sie bestehende Ungleichheiten unsichtbar machen.
Die Hautfarbe beeinflusse, wie Menschen wahrgenommen, behandelt und welche Chancen ihnen eingeräumt werden. Wer behauptet, „farbenblind“ zu sein, verweigere damit, reale Diskriminierung anzuerkennen.
Für Mailitafi ist Rassismus kein individuelles Fehlverhalten, sondern ein gesellschaftlich tief verankertes System. Von Bewerbungsverfahren über Bildung bis hin zur Polizeiarbeit prägen koloniale Kontinuitäten und institutionelle Vorurteile die Lebensrealität von Schwarzen.
Er beschreibt Racial Profiling als gängige Erfahrung, bei der sie häufiger kontrolliert oder verdächtigt werden, weil sie als Gefahr gelten. Dies sei kein Zufall, sondern Folge ihrer historischen Entmenschlichung im Kolonialismus, als sie als minderwertig dargestellt wurden, um Ausbeutung und Versklavung zu rechtfertigen.
Antischwarzer Rassismus, so erklärt Mailitafi, unterscheide sich von allgemeiner Diskriminierung durch seine besondere Verknüpfung mit kolonialer Gewalt und pseudowissenschaftlichen Ideologien. Diese Denkmuster wirken bis heute fort – etwa in der ungleichen globalen Wohlstandsverteilung, in der Afrika wirtschaftlich ausgebeutet und kulturell marginalisiert bleibt.
Ein besonders sensibler Teil des Gesprächs betrifft Rassismus in muslimischen Gemeinschaften. Mailitafi beobachtet, dass er auch hier existiert – obwohl sie selbst Ausgrenzung erfahren.
Viele Moscheegemeinden blieben ethnisch homogen, etwa türkisch, arabisch oder afghanisch geprägt, und unterschieden sich in Sprache, Kultur und sozialem Zugang. Das führe dazu, dass Schwarze sich oft ausgeschlossen fühlten. Bei manchen predige man über Gleichheit im Islam, praktiziere sie aber im Alltag nicht.
Mailitafi fordert die Moscheegemeinschaften deshalb auf, sich aktiv mit antischwarzem Rassismus auseinanderzusetzen. Der erste Schritt sei, offen über das Thema zu sprechen und es in Bildung und religiöse Praxis einzubetten. Moscheen sollten Workshops anbieten, Diversität fördern und Vorstände divers besetzen.
Er lobt als Beispiel eine Moschee in Osnabrück, eine Gemeinschaft mit über 30 Nationalitäten, in der Predigten auf Deutsch gehalten und interkulturelle Brücken betont werden. Solche Ansätze ermöglichten echte Begegnung und gegenseitiges Verständnis.

Foto: Reem Faruqi
Mailitafi nannte zusätzliche subtilere Rassismusformen innerhalb muslimischer Gemeinschaften – besonders bei der Partnersuche. Er beschreibt, dass in vielen Familien und Gemeinden ein tief verwurzeltes „ethnisches Sortieren“ existiere, das sich religiös rationalisieren lasse, tatsächlich aber rassistische Strukturen reproduziere.
So seien Schwarze – etwa aus afrikanischen Ländern bzw. mit afroeuropäischer Herkunft – oft nicht als gleichwertige Partner für arabische, türkische oder südasiatische Muslime akzeptiert.
Er betonte, dass diese Haltung nichts mit islamischer Theologie zu tun habe, sondern auf gesellschaftliche Hierarchien und koloniale Denkmuster zurückgehe, die auch in migrantischen Moscheegemeinschaften fortwirkten. Und erinnert daran, dass der Prophet Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, die Ebenbürtigkeit aller Gläubigen unterstrich und Ehen zwischen verschiedenen Ethnien befürwortete.
Wenn aber in heutigen Moscheen oder Familien „Hautfarbe und Herkunft“ noch über Liebes- und Eheentscheidungen entscheiden, zeige das, wie stark unbewusste Überlegenheitsgedanken weiterleben.
Er ruft daher zu offener Selbstkritik auf: Muslimische Gemeinden müssten die Frage der Eheschließung und Partnerwahl nicht nur als private, sondern als gesellschaftliche und politische Fragestellung begreifen. Denn Rassismus beginne oft dort, wo Menschen sich einbilden, „keine Vorurteile“ zu haben – aber dennoch andere ausschließen.
Hier geht es zum ganzen Interview: https://www.youtube.com/watch?v=-GMRCGijKXc

