
Denkanstoß zum Thema Gemeinschaft: Über die Zukunft der Muslime und das Phänomen der Macht
(iz). Hört man sich in der muslimischen Community um, ist die Klage der mangelnden Anerkennung durch die Politik und die Mehrheitsgesellschaft nicht zu überhören. Fakt ist: Muslimische VertreterInnen tauchen in den Debatten rund um die millionenfache Präsenz der Muslime in Deutschland nur selten auf. Eigene Positionen gehen unter – seien sie zum Nahostpolitik, zu den Krisen unserer Zeit, der Ökonomie oder zur Gerechtigkeitsfrage.
Gemeinschaft: Muslime klagen über mangelnde Anerkennung
Im Kern dreht sich der Diskurs ohne eine adäquate Repräsentanz der Betroffenen um Phänomene wie Immigration, Sicherheit oder die Rolle des sogenannten politischen Islam in der Zukunft. Warum muslimische Stimmen ungehört bleiben, hat vielfältige Gründe, die auch mit dem aktuellen Organisationsgrad der Muslime selbst zu tun haben.
Betrachtet man das Verhältnis zwischen einer der größten Minderheiten im Land und der Politik, geht es letztlich um gesellschaftliche Macht. Der Soziologe Max Weber hat Macht als die Möglichkeit definiert, den jeweils eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.“
In dieser Definition liegt das Problem verborgen: Während Muslime befürchten, dass die staatliche Macht eines Tages die Religionsfreiheit einschränkt und legitime Ansprüche der muslimischen Gemeinschaft weiter zurückdrängt, befürchtet die säkulare Gesellschaft, dass muslimische Organisationen langfristig die demokratische Ordnung verändern.
Letztere Ängste werden – zumindest in rechtskonservativen Kreisen – mit dem Schlagwort der angeblichen „Islamisierung Europas“ instrumentalisiert. Paradoxerweise ist von dieser Machtergreifung wenig zu sehen, denn Muslime sind weder in nationalen, noch europäischen Parlamenten, genauso wenig wie in anderen gesellschaftlich wichtigen Positionen relevant vertreten.
Es stimmt eher bedenklich, dass sich vor allem junge Muslime enttäuscht aus dem gesellschaftlichen Engagement und dem islamischen Gemeindeleben verabschieden.
Was ist unser Verhältnis zum Politischen?
Die Diskussion des Verhältnisses der Muslime zum Begriff des Politischen ist eine der wichtigsten innermuslimischen Fragen unserer Zeit. Ohne eine Klärung dieser offenen Frage, so die hier vertretene These, wird es keine Anerkennung geben.
Man muss es zugestehen: Der moderne politische Islam der letzten hundert Jahre hat den Staat und damit die Ausübung von Macht, als eines ihrer zentralen Ziele ausgegeben. Das Ergebnis ist ernüchternd: Bürgerkrieg, Diktatur und Terrorismus sind die wiederkehrenden Erscheinungsformen im Rahmen des Kampfes um die Macht. Der Begriff des „islamischen“ Staates als ein Ziel politischen Handelns ist damit diskreditiert und regt die Selbstanalyse an.
Warum sind die Stimmen, die auf die ausgleichenden, spirituellen, ökonomischen und sozialen Komponenten des Islam verweisen auch in der Community kaum hörbar? Hier liegt auch ein Schlüssel zu einem geistigen Zustand, der sich jenseits von Machtphantasien und dem Gefühl der Ohnmacht bewegt.
Zur Analyse gehört auch die nüchterne Feststellung, dass die freie islamische Lehre, die unabhängig vom politischen Einfluss wirkt, heute allein in Europa möglich ist.

Öffentliche Veranstaltung der SCHURA Hamburg mit Rüdiger Nehberg in der Merkez-Moschee. (Foto: SCHURA Hamburg)
Hannah Arendt über Macht: Kommunikation und soziale Aktion
Hannah Arendt versteht die Macht als die Fähigkeit, sich in zwangloser Kommunikation auf ein gemeinschaftliches Handeln zu einigen. Einzige Alternative zum Zwang ist freiwillige Verständigung der beteiligten Subjekte untereinander: „Macht entspringt der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“
Das Grundphänomen der Macht ist aus Sicht der Philosophin nicht die Instrumentalisierung eines fremden Willens für eigene Zwecke, sondern die Formierung eines gemeinsamen Willens in einer auf Verständigung gerichteten Kommunikation.
Interessant ist es, diesen Gedanken nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch für unsere eigene Organisationsformen anzuwenden. Für die Zukunft der muslimischen Organisationen im 21. Jahrhundert ist es wichtig, das Selbstverständnis gegenüber der Macht zu klären und sich zu ihrer Verortung in der Zivilgesellschaft zu bekennen.
Die Reduzierung des Islams auf eine politische Ideologie, die unsere Gegner und kleine Teile unserer eigenen Gemeinschaft anstreben, ist kein Zukunftsmodell. Bedenklich stimmt, dass immer mehr radikale Stimmen, die sich aus einem Ressentiment gegen die Gesellschaft nähren und von der Erringung der Macht träumen, den öffentlichen Raum prägen.
Wenn wir unsere Stimmen im Diskurs stärken und unsere Rolle in der Gesellschaft ausbauen wollen, geht es nicht nur darum, unsere vielfältigen Themen kompetent zu vertreten, sondern auch unsere Organisationsformen der Zeit anzupassen. In diesem Kontext ist in den letzten Jahrzehnten relativ wenig geschehen. Viele religiöse Gemeinschaften haben eine lange Geschichte und Tradition, die auf bestimmte Hierarchien basieren.
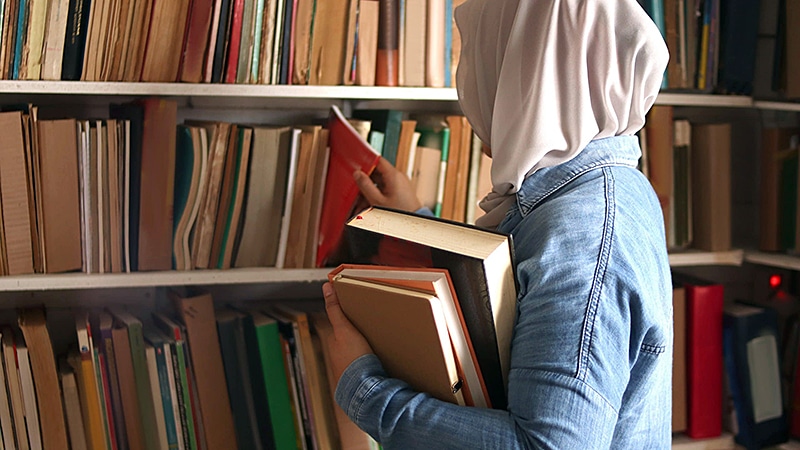
Foto: Adobe Stock
Die Pfeiler des Islamischen Lebens
Menschen suchen oft eine klare Struktur, vor allem in spirituellen oder moralischen Fragen, in denen Autorität und Weisheit geschätzt werden. Die muslimischen Vereine, die sich auf der verlässlichen Grundlage der islamischen Rechtsschulen bewegen, spielen in Deutschland eine wichtige Rolle.
Sie sind ein Pfeiler des islamischen Lebens: Ihr Verdienst war es, aus dem Nichts eine beachtliche Infrastruktur aufzubauen. Zu ihrer Erfolgsgeschichte gehört, dass Moscheen heute beseelte, aus der Nachbarschaft unserer Stadt längst nicht mehr wegzudenkende Orte sind.
Trotz der wichtigen Rolle der bestehenden Vereinsstrukturen ist der Veränderungsdruck auf traditionelle Organisationen in einem sich im Wandel befindlichen öffentlichen Raum spürbar. Ob religiöse oder gemeinnützigen Vereine noch zeitgemäß sind, hängt stark von den Werten und Zielen der jeweiligen Gemeinschaft ab.
Für diejenigen, die nach Stabilität, Tradition und klarer Führung suchen, können solche Strukturen nach wie vor sinnvoll sein. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zu finden zwischen der Wahrung von Traditionen und der Anpassung an moderne Vorstellungen von Gemeinschaft und Verantwortung.

Foto: Kaitlyn Baker / Unsplash
Neue Strukturen können das Vereinsmodell ergänzen
Der Einfluss der sozialen Medien auf unser Verhalten, insbesondere auch auf die junge Generation, gibt hier einen klaren Hinweis. Im 21. Jahrhundert – insbesondere mit der unaufhaltsamen Verbreitung von modernen Kommunikationsmitteln – beginnen sich Organisationsstrukturen zu verändern.
Hier spielt das Internet und die digitale Vernetzung eine zentrale Rolle. Die Entwicklung von sozialen Netzwerken, wie sie vor allem durch Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn hervorgebracht wurden, hat die Art und Weise verändert, wie sich Menschen zu gemeinschaftlichen Zwecken organisieren.
Statt einem traditionellen Vereinsmodell, das auf festem Mitgliedsbuch und organisierten Treffen basiert, entstehen heute dynamische, oft virtuelle Netzwerke, die sich schnell und flexibel an die Bedürfnisse der Mitglieder anpassen können.
Und es gibt heute im Netz zahlreiche Influencer, die im Vergleich zu den „mächtigen“ Vereinsstrukturen der Vergangenheit über größere Reichweite und stärkeren Einfluss insbesondere auf die Jugend verfügen. Insoweit diese Stimmen sich auch an einer verbindlichen Definition des Islams versuchen, sind die künftigen Probleme voraussehbar.
Um sich auf die neue Lage einzustellen, muss man sich zunächst die Vorteile der neuen Strukturen bewusst machen. Im Vergleich zu den klassischen, oft hierarchischen Vereinsstrukturen, bietet das Netzwerkmodell eine flexiblere, dynamischere und partizipativere Möglichkeit zur Organisation. Hierarchien werden in der Regel minimiert, und gemeinsame Entscheidungsprozesse (z.B. durch Konsens oder demokratische Abstimmungen) stehen im Vordergrund. Die Mitglieder sind gleichberechtigt und es gibt keine zentrale Autorität, die das Sagen hat.
Das Zusammenspiel zwischen den traditionellen Vereinen und den neuen Netzwerken zu justieren und im Ergebnis der Fragmentierung muslimischer Stimmen entgegenzutreten, ist zweifellos eine Herausforderung.

Foto: Freepik.com
Wie lässt sich das Digitale in reales Handeln übersetzen?
Das Potential der Mobilisierung in den sozialen Medien ist offensichtlich. Die digitale Vernetzung hat die Kommunikation und den Austausch von Informationen erheblich beschleunigt. Über soziale Netzwerke, Foren und Plattformen können sich Menschen zu bestimmten Themen oder Zielen schnell zusammenschließen und Ideen austauschen.
Wenn die Ideen und Verbindungen, die in digitalen Räumen entstanden sind, in reale Handlungen umgesetzt werden, entsteht das Zusammenspiel, das die Grundlage für nachhaltige Gemeinschaften und Projekte bildet. Das können zum Beispiel Genossenschaften, Gilden, Medien oder lokale Islamkonferenzen sein, bei denen Menschen sich physisch begegnen und direkt zusammenarbeiten.
Hier wird die virtuelle Verbindung durch persönliche Kommunikation und gemeinsames Tun intensiviert und vertieft. Erst durch die physische Präsenz, das Teilen von Erfahrungen und die direkte Zusammenarbeit wird die Tiefe der Beziehungen erst wirklich spürbar.
Der ideale Netzwerkansatz könnte in einer Mischform bestehen: Virtuelle Räume bieten eine flexible Plattform für den Austausch und die Planung, während die realen Treffen der Ort sind, an dem Ideen umgesetzt, Beziehungen vertieft und konkrete Projekte realisiert werden. Diese hybride Form könnte in vielen sozialen Bewegungen eine wichtige Rolle spielen – von religiösen Organisationen über kreative Gemeinschaften bis hin zu ökonomischen Initiativen.
Die Zukunft der Netzwerke könnte in dieser hybriden Form liegen – einer Kombination aus der Effizienz und Reichweite der virtuellen Welt und der Tiefe und Authentizität der realen Begegnung. Das Virtuelle bietet die Basis, den Austausch und das Lernen, während die physische Präsenz die Verbindung und das tatsächliche Handeln ermöglicht.
Für die islamischen Verbände wird es wichtig sein, zu entscheiden, ob sie eine Brücke zu diesen Netzwerken aufbauen oder sie einfach ignorieren. Wenn die Stimmen der Muslime in der Öffentlichkeit stärker vernehmbar sein sollen, gilt es hier Synergien – vor allem bei Themen die alle Muslime in Deutschland betreffen – anzustreben. Die Absicht muss sein, nicht nur die eigene Struktur zu stärken oder auszubauen zu wollen, sondern wichtige Ziele auch übergreifend gemeinsam zu verfolgen.

Foto: Freepik.com
Wir brauchen einen Mentalitätswandel
Zweifellos ist hier ein Mentalitätswandel notwendig. Eine Politik, die keine Macht anstrebt, könnte als eine Form der Anti-Macht-Politik beschrieben werden, die weniger auf die Eroberung oder Ausübung von staatlicher Macht ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf die Förderung von gesellschaftlichem Wandel durch alternative Wege und Strukturen. Sie verfolgt möglicherweise das Ziel, bestehende Machtstrukturen zu hinterfragen und zu kritisieren, ohne selbst an deren Stelle zu treten.
Insgesamt könnte man eine solche Politik als politische Ethik verstehen, die darauf abzielt, eine kritische Haltung gegenüber bestehenden Machtstrukturen einzunehmen und alternative Formen der sozialen Organisation zu fördern, ohne dabei die Macht im traditionellen Sinne übernehmen zu wollen.
Anstatt Macht als eine Form der Kontrolle oder Herrschaft zu sehen, könnte sie als eine Art Potential betrachtet werden – als die Fähigkeit der Gemeinschaft, in Vielfalt zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu handeln. In der islamischen Tradition war es das Stiftungswesen, dass symbolisch für diesen Ansatz steht.
Ein neuer Politikbegriff könnte Kunst, Bildung und Philosophie als Grundpfeiler unserer ganzheitlichen Gemeinschaft integrieren. Diese Disziplinen sind nicht nur Instrumente der kulturellen oder intellektuellen Bereicherung, sondern auch einwegweise Schlüssel zur Förderung von Verständnis, Empathie und Zusammenarbeit.
Kunst könnte als eine Form der kommunikativen Praxis verstanden werden, die es den Menschen ermöglicht, neue Perspektiven und Ideen zu entwickeln und unsere Narrative auszudrücken.
Sie hat das Potential, tief in den emotionalen und kognitiven Raum der Gemeinschaft einzutauchen und damit neue politische Räume zu eröffnen, in denen Selbstreflexion, Kritik und Transformation stattfinden. Bildung würde in diesem Kontext nicht nur auf religiöses Wissen abzielen, sondern auch auf die Förderung von kritischem Denken, Empathie und ganzheitlichem Lernen, das die Menschen zu aktiven und verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft macht. Philosophie könnte eine zentrale Rolle spielen, um zu hinterfragen, was es bedeutet, in der Moderne zu leben, was der gute Umgang miteinander ist und wie man Moral, Ethik und Gerechtigkeit in einer offenen, diversen Gesellschaft verwirklichen kann.
Die wichtige Unterscheidung zwischen kulturellen Gepflogenheiten und islamisch verbindlichen Verhaltensweisen zu definieren, wird in einem multikulturell bestimmen Land immer wichtiger. Zudem sind die ethnischen Trennlinien, die muslimische Organisationen nach wie vor prägen, auf Dauer nicht mehr zu halten.
Die Vision, Kunst, Bildung und Philosophie in unseren Politikbegriff zu integrieren und den organisierten Islam und die neuen Netzwerke nicht als Gegensätze zu sehen, sondern zu verknüpfen, könnte eine völlig neue, kreative Art der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung in Gemeinschaften schaffen.
Fest steht: Wir leben in Zeiten, in denen Organisationen und Menschen sich auf Veränderungen einstellen müssen. In Europa geht es um die Verteidigung der Zivilgesellschaft, um die Zurückweisung einer Identitätspolitik, die den Menschen auf seine Herkunft reduziert, statt auf eine gemeinsame Bildung, ethisches Verhalten und Sprache zu setzen. Die Rolle der Muslime in diesem Kontext zu klären benötigt weitere Denkanstöße und eine Stärkung des innermuslimischen Dialogs.

