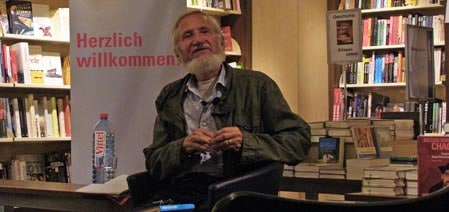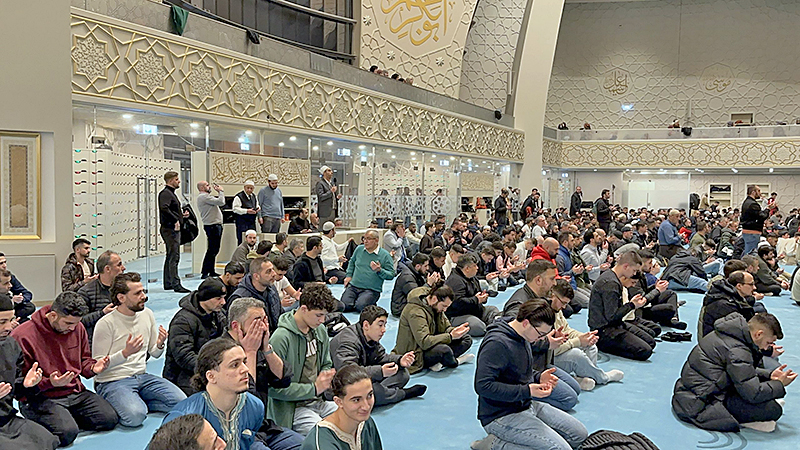(iz). Die Einrichtung von universitären Lehrstühlen der so genannten „Islamischen Theologie“ und die im Zusammenhang stehende Einführung eines „Islamischen Religionsunterrichts“ gelten vielen als der wichtigste materielle Fortschritt für muslimische Community in den letzten Jahren. Insbesondere, weil in den Augen mancher so eine Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft und Körperschaft des öffentlichen Rechts mit vorbereitet werden könne.
Jenseits religions- und bildungspolitischer Fragen stellt die „Islamische Theologie“ eine ambivalente Entwicklung dar. Einerseits, so die Hoffnung der Beteiligten, könne eine nicht radikalisierte Schicht aus islamrechtlichen Gebildeten entstehen. Andererseits, so die legitime Befürchtung anderer, bestünde die Gefahr der Schaffung eines politisch genehmen Islamverständnis. Bisher ist vollkommen unklar, inwieweit die Freiheit der islamischen Lehre in Einklang mit dem akademischen Betrieb gebracht werden kann. Hierzu sprachen wir mit der Islamwissenschaftlerin Nimet Seker, die sich in Münster auf ihre Doktorarbeit vorbereitet.
Nimet Seker studierte in Köln Islamwissenschaft, Germanistik und Ethnologie. Nach dem Ende ihres Studiums 2006 orientierte sie sich im Medienbereich und fand einen Platz in der online-Redaktion von Qantara.de, wo sie heute als Redakteurin tätig ist. Seker arbeitet auch als Autorin für andere Medien. Seit Oktober 2011 ist sie Stipendiatin am „Graduiertenkolleg für Islamische Theologie“ an der Universität Münster und konzentriert sich auf ihre Doktorarbeit. Daneben gibt die umtriebige Islamwissenschaftlerin halbjährlich das Magazin „Horizonte. Zeitschrift für muslimische Debattenkultur“ heraus.
Islamische Zeitung: Liebe Nimet, sie machen ja die unterschiedlichsten Dinge – von der Doktorarbeit bis hin zum Herausgeben eines Halbjahresmagazins. Was treibt Sie an und begeistert Sie?
Nimet Seker: (überlegt)… Ich habe in den letzten Jahren einen Durst nach Wissen entwickelt. Nach der Universität wollte ich erst einmal nur berufliche Perspektiven für mich entwickeln und der Journalismus hat mich interessiert. Bekanntermaßen haben wir muslimische Frauen mit Kopftuch es auf dem Arbeitsmarkt ohnehin nicht sehr leicht. Das war der Ausgangspunkt meines Engagements im Bereich Medien.
In den letzten beiden Jahren wurde meine Suche nach Wissen auch durch das neue Fach der „Islamischen Theologie“ mit entfacht. Je mehr ich dazulerne, desto mehr merke ich eigentlich, wie wenig ich weiß. Ich möchte das, was ich mir angeeignet habe, an andere weitergeben.
Islamische Zeitung: Haben sie manchmal das Gefühl, zwischen der Innenbetrachtung als Muslim und dem wissenschaftlichen Objektivismus der Universität hin- und herspringen zu müssen?
Nimet Seker: Nein, das Gefühl habe ich nicht. Natürlich hat man in der akademischen Welt den Anspruch, auf einer anderen Ebene zu agieren. Hier werden häufig Fragen behandelt, die für Muslime im Alltag vielleicht irrelevant scheinen – historische Dispute der Mutakallimun, Methoden der Qur’anexegese, neue hermeneutische Ansätze usw.
Im Gegensatz zu meinem Studium der Islamwissenschaft habe ich nicht das Gefühl, zwischen Binnen- und Außenperspektive wechseln zu müssen. In der Islamwissenschaft fiel mir irgendwann auf, dass ich eine klare Trennung zwischen meiner eigenen Gläubigkeit und dem, was ich in der Universität lernte, zog. Das hatte auch damit zu tun, dass das, was ich in der Islamwissenschaft in Köln (wo ich auch Lehrveranstaltungen abhielt) lernte, mit dem eigentlichen religiösen Gehalt nichts zu tun hatte. Da ging es eher um historische oder kulturhistorische Fragen.
Jetzt, bei der „Islamischen Theologie“, wird die Binnensicht dadurch gestärkt, dass wir viel mit Theologen anderer Religionen zu tun haben, die uns Muslimen unsere Positionen spiegeln und stellenweise kritisch in Frage stellen. Das führt dazu, dass man bei sich selbst über die Bedeutung der Offenbarung Gedanken macht. Dies hat sowohl meinen Zugang zum Islam gestärkt, als auch meinen Glauben gefestigt.
Islamische Zeitung: Können sie die fundierte Kritik an der „Islamischen Theologie“ nachvollziehen, die in dieser eine problematisch Neuschöpfung sieht?
Nimet Seker: Ich habe hier keine eindeutige Position. Anfänglich war auch ich sehr skeptisch. Auch in der Phase, als ich mich für das Doktorandenstudium bewarb, war mir nicht klar, wie sich das Fach entwickelt. Es ist natürlich klar, dass es sich hier um eine, von der deutschen Bildungspolitik angestoßenen Sache handelt. Es sollen Religionslehrer und Imame ausgebildet werden. Letztendlich führt es aber auch dazu, dass wir in Deutschland auf das zurückgreifen, was man im Arabischen „Turath“ (intellektuelles Erbe) nennt. Und zwar nicht von säkularen Diskursen, sondern auch von klassischen islamischen Disziplinen.
Je länger ich mich mit dem Fach beschäftigte, desto weniger kann ich die Kritik nachvollziehen. Was ich zum Beispiel kritisch sehe, ist die vorschnelle Besetzung der Professuren. Es gibt nicht genug qualifiziertes Personal, sodass man auf Islamwissenschaftler oder Personal aus Nachbardisziplinen bis hin zu Leuten aus den Gesellschaftswissenschaften zurückgreifen muss. Das führt stellenweise zu einer Schieflage. Würde man ein Paar Jahre warten, hätten wir vielleicht mehr qualifizierte Leute. Das sind aber hochschulpolitische Fragen. Auf inhaltlicher Ebene – und da urteile ich nach meiner Erfahrung aus dem Graduiertenkolleg – kann ich die Kritik nicht nachvollziehen.
Islamische Zeitung: Es gibt aber bis in unsere Zeit nichts in den islamischen Wissenschaften, was sich mit „Theologie“ übersetzen ließe…
Nimet Seker: Natürlich nicht, das ist aber auch nicht gemeint. Der Begriff war ein Notbehelf. Ursprünglich schlug der Wissenschaftsrat den Begriff „Islamischen Studien“ vor, aber das wäre im internationalen (englischsprachigen) Kontext missverständlich gewesen, weil dort die europäisch-säkulare Islamwissenschaft „Islamic Studies“ heißt. Auch wenn sich der Name eingebürgert hat, ist dies kein Gegenstück zur christlichen Theologie. Wir vertreten die klassischen Disziplinen Fiqh, Tafsir, Kalam/Aqida usw. Hinzu kommt das neue Fach der Islamischen Religionspädagogik. In Hinsicht der Wissensgebiete richten wir unser Fach aber nicht nach christlich-theologischen Kriterien aus.
Islamische Zeitung: Liebe Nimet Seker, Vertreter ihrer Fachrichtung haben auch im Gespräch mit uns den Vorwurf zurückgewiesen, dass es sich hier um den Versuch der politischen Einflussnahme auf die Lehre des Islam handeln könnte. Von Einrichtungen wie der Mercator-Stiftung sind Mittel geflossen und nichtmuslimische Stimmen sprechen gelegentlich von einem „staatlichen Zähmungsinteresse“. So mancher Vertreter des Faches wird ja in den Medien auch als Repräsentant des deutschen Islam positiv aufgewertet. Ist der Verdacht wirklich so abwegig, dass hier ein politisch genehmes Islamverständnis geschaffen werden soll?
Nimet Seker: Ich würde nicht in Frage stellen, dass es dieses Interesse gibt. Meine Kritik an den Kritikern lautet: Man sollte sich den Blick auf das Fach nicht durch bestimmte Einzelpersonen verstellen lassen, weil diese nicht für die Zukunft stehen. Gerade entsteht eine ganze Generation von Nachwuchswissenschaftlern, die die Kategorien von „traditionell“ und „fortschrittlich“ sprengen. Wie Eren Güvercin in seinem Buch „Neo-Moslems“ schreibt, lassen sie sich nicht mehr in Kategorien des medialen Diskurses pressen. Sie sind tief in ihrem Glauben verwurzelt; und viele auch in der Community. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass einige von ihnen eine Imam-Ausbildung haben oder Verbindungen zu den Verbänden unterhalten. Ich kann nicht erkennen, dass die Kluft, von der viele Kritiker sprechen, so existieren würde.
Mich stört das Misstrauen, das von den Verbänden, wie jüngst beim IGMG-Symposium, ausgesprochen wird. Es waren ja die Verbände, die jahrelang dafür arbeiteten, dass es in Deutschland einen islamischen Religionsunterricht gibt. Dieser soll bald in NRW und in Niedersachsen kommen. Dafür braucht es die Einrichtung entsprechender Studiengänge an den Universitäten, weil das Recht die akademische Ausbildung solcher Lehrkräfte vorsieht. Wo und wie sollten sie denn sonst ausgebildet werden? Mein Einladung an die Kritiker ist, dass sie sich auf den entsprechenden theologischen Tagungen und Seminaren einbringen. Da es in der islamischen Lehre kein staatliches Monopol bei der Gelehrsamkeit gibt, ist jeder aufgerufen, sich an der Debatte auf entsprechendem Niveau zu beteiligen.
Islamische Zeitung: Es gibt im deutschen Mainstreamislam kaum öffentlich auftretende Gelehrte. Es dürfte den meisten schwerfallen, mehr als zehn hiesige Gelehrte zu benennen…
Nimet Seker: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Auf staatlicher Seite besteht die Sorge, dass es so genannte „extremistische“ Prediger von salafistischer Seite gibt, die auf Deutsch predigen und in kürzester Zeit in Medien sowie unter jungen Muslimen Gehör gefunden haben. Aus unserer Sicht ist das natürlich nur ein Randphänomen…
Aber aus nichtmuslimischer Sicht sind das diejenigen, die von jungen Leuten als Gelehrte wahrgenommen werden. Ein Interesse staatlicher Seite war es, ihnen zuvorzukommen, indem man eine wissenschaftliche Ausbildung implementiert und solchen Menschen Alternativen zu bieten, die ein Interesse an islamischer Lehre haben.
Islamische Zeitung: Noch einmal gefragt, ist es nicht ein Problem der muslimischen Community in Deutschland, dass es hier zu wenig strukturierte Gelehrsamkeit des Islam gibt?
Nimet Seker: Natürlich, diese Erfahrung machen wir als Wissenschaftler auch. Wir sind oft reine Schriftgelehrte, da es an der Universität keine klassische Madrassa-Ausbildung gibt. Oft merken wir bei bestimmten Fragen, dass man sich lieber an einen Lehrer wenden würde, der ein Wissen hat, das nicht nur aus Büchern kommt. Im Gegenzug sehe ich viele muslimische Akademiker, die sich an Privatinstitute in Deutschland, Frankreich oder im Nahen Osten wenden, wo sie Wissen über Scharia-Lehre oder andere Gebiete erwerben wollen. Wir haben hier keine traditionellen Gelehrten und oft dominiert „Schaikh Google“. Die Frage ist, ob wir als universitäre Repräsentanten hier langfristig eine Alternative darstellen können. An diesem entscheidenden Punkt müssen wir arbeiten.
Islamische Zeitung: Für viele Muslime, insbesondere die Jugend, ist das Internet zu einem sehr wichtigen Mittel geworden, mit dem sie sowohl Wissen über den Islam erlangen wollen, als auch einen Teilaspekt ihrer muslimischen Identität ausleben. Gibt es eine Möglichkeit, die modern Kommunikation mit der Tradition zu versöhnen?
Nimet Seker: Immer mehr Personen und Institutionen, die traditionelles Wissen für sich in Anspruch nehmen, nutzen das Internet dazu. Ich glaube nicht, dass sich beide Aspekte ausschließen. Es gibt Gelehrte wie Abdulhakim Murad, die Vorträge und Seminare live im Internet übertragen. Ich würde mir wünschen, dass in dieser Hinsicht mehr passiert, weil man als Akademiker nur das Wissen greifen kann, das zur Verfügung steht. Sei es in Form von persönlichen Quellen, von Büchern und elektronischen Medien. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir uns mehr für das engagieren, was Sie als traditionelle Gelehrsamkeit bezeichneten.
Islamische Zeitung: Aber wird die Übertragung des Wissens von Lehrer auf Schüler nicht durch die virtuellen Aspekte des Internets konterkariert?
Nimet Seker: Natürlich wird es das. Auch wenn wir von islamischer Lehre sprechen, bewegen wir uns immer noch innerhalb säkularisierter Strukturen. Will man wirklich die traditionelle Lehre und ihre Methode in die Gegenwart transportieren, müsste man in der lokalen Moschee einen Gelehrten haben. Davon gibt es aber nicht viele; und werden sie auch in so schneller Zeit nicht haben.
Islamische Zeitung: Es gibt den wachsenden akademischen Diskurs und parallel den Diskurs, wie er vom organisierten Islam geführt wird. Sehr viel Metaphysik, sehr viel Reflexion… aber wo bleibt die Aktion? Sehen Sie hier – auch als aktive junge Muslimin – eine Diskrepanz?
Nimet Seker: Ja. Ich sehe diese Diskrepanz, aber ich sehe bei denjenigen, die zehn Jahre jünger sind als ich, das Verlangen, die Ebene der Reflexion zu verlassen und zum Handeln überzugehen. Ich glaube, dass ist das Erbe derjenigen, von denen wir unseren Islam gelernt haben: unsere Eltern und Großeltern. Die große Masse der Muslime sind immer noch die Kinder der Gastarbeiter. Ich kann mich erinnern, dass wir in unserer Familie bis zu meinem 13. oder 14. Lebensjahr davon gesprochen haben, in die Türkei zurückzukehren. Man hat sich darum bemüht, dass hier Moscheen entstehen und dass die Kinder den Islam lernen, worauf in meiner Familie sehr viel Wert gelegt wurde. Das meiste habe ich von meinen Eltern gelernt. So findet islamisches Lernen und islamisches Handeln immer statt: in der Gemeinschaft.
Dass wir jetzt diese Intellektualisierung haben, ergibt sich durch den äußeren Druck. Dieser drängt uns in die Defensive und zwingt uns zu ständiger Positionierung, egal zu welchen Fragen. Das fängt an bei dem Thema Integration, über Extremismus und bis hin zur Auseinandersetzung mit christlichen Theologen, die wissen wollen, wie Jesus im Islam gesehen wird.
Es liegt an den Muslimen selbst, dies in Handeln umzusetzen. Ich muss mich hier selbst kritisch hinterfragen, da ich oft fatalistisch denke und glaube, als einzelne wenig ändern zu können. Sich der Bedeutung der Gemeinschaft bewusst zu werden, ist in der Moderne beinahe verloren gegangen. Insbesondere in der Diaspora, wobei ich diesen Begriff eigentlich auch nicht mag. So etwas wie Diaspora kann es im Islam eigentlich nicht geben, da ich überall – in Indonesien, in der Türkei oder in Deutschland – Muslim bin.
Islamische Zeitung: Sie geben auch noch die Halbjahreszeitschrift „Horizonte“ heraus. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Nimet Seker: Als der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen für die Einführung der „Islamische Theologie“ an staatlichen Universitäten veröffentlichte und es klar wurde, dass die Bildungspolitik die Einrichtung des Fachs nun voran treibt, befürchtete ich, dass staatliche Bildungsinstitutionen ein Monopol über die Islamdiskurse erlangen würden. Die ursprüngliche Idee hinter dem Projekt war die Schaffung einer Gegenstimme. Es geht uns darum, Themen auf eine vertiefte Art und Weise aufzugreifen, die nicht nur Muslime beschäftigen, sondern die zeigen, dass sich Muslime als Teil der Gesellschaft begreifen. Die ersten beiden Ausgaben fielen eher akademisch aus: Die erste behandelte Idschtihad als Werkzeug des islamischen Rechts und die zweite führte in die Lehre von Imam Al-Ghazali ein.
Mit der dritten Ausgaben über Geld, ethisches Wirtschaften und das Konzept des so genannten „Islamischen Bankwesens“ geht es mir darum zu zeigen, dass sich Muslime mit drängenden Zeitfragen beschäftigen und nicht nur so tun, als wäre der Islam nur für einige wenige Dinge in unserem Leben von Bedeutung. Ich glaube, dass wir über unsere individuelle religiöse Lebenspraxis hinaus etwas zur Gesellschaft beizutragen haben.
Islamische Zeitung: Das Projekt trägt auch den Titel „Zeitschrift für muslimische Debattenkultur“. Heißt das, es besteht in der Community ein Nachholbedarf?
Nimet Seker: Ich sehe einen großen Nachholbedarf, weil wir in Deutschland durch die vielen öffentlichen Debatten in die Defensive gerieten. Das führt dazu, dass wir uns in Mainstreammedien immer nur in bestimmten Formen äußern. Das erkennt man unter anderem daran, dass immer die gleichen Personen zur Sprache kommen, während andere Personen ignoriert werden und die Medien in Deutschland sich bewusst oder unbewusst nach der politischen Wetterlage ausrichten. Aber wir Muslime passen uns auch dem Druck der Debatten an und können kaum eigene Themen setzen. Hinzu kommt, dass Muslime in Deutschland kaum Medienmacht besitzen. Es entscheiden die Redakteure, wer zu welchem Thema was schreiben oder produzieren darf. Auf der muslimischen Seite ist man größtenteils nur passiv und scheint so etwas wie Streitkultur nur zu kennen, wenn es darum geht, etwa auf der Welle der Sarrazin- oder Kelek-Empörung zu reiten. Zum anderen interessieren sich Medien für Islam nur dann, wenn man über Sensationelles berichten kann, seien es nun gewaltbereite „Salafisten“ oder Muslime, die für die Homo-Ehe sind. Zum dritten entsteht Autoren- und Themenwahl immer vor dem Wissenshorizont der Medienmacher großer Zeitungen oder Medienanstalten.
Vor kurzem erhielt ich via Email die Anfrage eines Hörfunkjournalisten, der von mir wissen wollte, wen ich für die prägenden muslimischen Köpfe in Deutschland hielte. Meine Antwort war, dass ich die am häufigsten in den Medien auftauchenden Personen für unwichtig erachte, weil sie von Muslimen gar nicht als wichtig wahrgenommen werden. Ich habe ihm Personen genannt wie den traditionellen Gelehrten und Mawlawi-Schaikh Abullah Halis oder Erika Theissen, die das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen in Köln aufgebaut hat und immenses leistet. Solche Personen sind in den Medien kaum präsent, hinterlassen aber etwas Prägsames.
Islamische Zeitung: Wie sahen die Reaktionen auf Ihre Zeitschrift aus?
Nimet Seker: Das Feedback war durchweg positiv. Aber, wie es häufig ist, bleibt es oft nur bei der Begeisterung. Es folgen leider keine weiteren Taten. Ich wünsche mir, dass sich mehr Autoren melden, die zu den drängenden Themen der Zeit schreiben möchten. Übrigens schreiben für „Horizonte“ auch Nichtmuslime. Dadurch, dass ich andere Themen als die setze, die uns vom Mainstream vorgegeben werden, merke ich, dass wir uns immer noch stark im vorgegebenen Diskurs bewegen. Fragen wie die nach einer gerechten Wirtschaftsordnung beispielsweise werden in unserer Gesellschaft, aber auch unter Muslimen nur am Rande thematisiert.
Stattdessen geht es um Integration, liberal versus konservativ oder den Salafismus. Gerade das letztere interessiert mich auf der öffentlichen Ebene überhaupt nicht, da man den Neo-Salafisten überhaupt nur mit starken, religiösen Argumenten beikommt. Dafür muss man aber seine Religion gut kennen, um ihr Verständnis von Qur’an und Hadithen widerlegen zu können.
Islamische Zeitung: Von Goethe stammt die Maxime, dass man eine Sache nur dann verstehen kann, wenn man sie liebt…
Nimet Seker: Das ist eine Maxime, die ich mir vielleicht noch mehr aneignen sollte. In vielen Dingen denke ich noch viel zu abstrakt. Viele Nachwuchs-Theologen haben einen sehr starken Bezug zu ihrem Glauben und sie werden durch das, was wir hier tun, sehr berührt. Diese Liebe und diese Leidenschaft sollte man bei allem, was man tut, natürlich nie vergessen.
Islamische Zeitung: Liebe Nimet Seker, danke für das Gespräch.