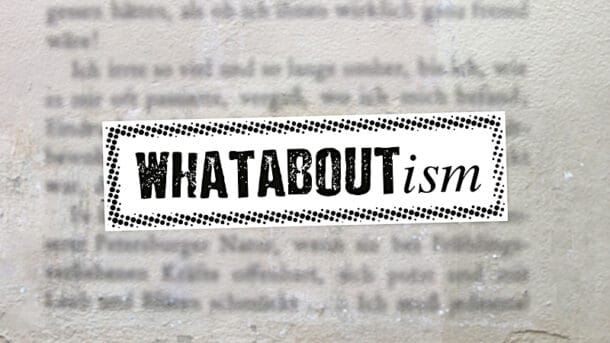
(iz). Das Internet hat ihn bekannt gemacht: den Whataboutism. Er ist eine beliebte Technik, den Fokus eines Gesprächs oder einer Debatte zu verändern. In letzten sieben Jahren kennt man ihn von Rassisten, die Gewalt gegen Flüchtlinge mit dem Verweis auf imaginierte oder reale Verbrechen einzelner Geflüchteter begegneten. In der erhitzten Diskussion um Pandemie und Maßnahmen wurde er massiv ausgeweitet.
Laut dem Online-Lexikon Wikipedia wurde dieser Begriff 2008 vom Journalisten Edward Lucas (in „The Economist“) populär gemacht. Demnach handle es sich dabei um einen russischen „Propaganda-Trick“. Dieses Vorgehen sei „seinerzeit der Sowjetunion für ihren Umgang mit Kritik aus der westlichen Welt vorgehalten“ worden. Im politischen Bereich dient er demnach dazu, um Kritik am eigenen Land (oder Lager) dadurch abzuwiegeln, dass mit dem Satz „Was ist mit…?“ auf Begebenheiten der Gegenseite abgewiegelt werde.
Der Kommunikationstrainer und Autor Stefan Häseli bezeichnet diese Gesprächstaktik als „schnell mühsam“, die zu nerven beginne. Er rät zu einer „einfachen wie wirksamen“ Lösung: „Entweder, man spricht den Whataboutism an – oder man klammert das entsprechende Thema von vornherein aus.“ Das könne funktionieren, müsse es aber nicht. Voraussetzung sei die Bereitschaft zu einem Dialog auf beiden Seiten.
So ist es kein Wunder, dass diese Strategie bei der Debatte um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zum Einsatz kommt. In der Gesamtheit liegt das wohl weniger daran, dass das Netz voller „Putin-Trolle“ ist, sondern eher, weil sich diese Technik so unwidersprochen als legitim durchgesetzt hat. Im AfD-affinen Milieu, bei diversen „Querdenkern“ und bedauerlicherweise in Teilen von Kreisen, die sich selbst für „kritisch“ halten, findet sich dieses Phänomen. Die Behandlung der militärischen Aggression Putins wird mit dem Verweis auf die realen Untaten der US-Politik und manchmal mit kompletten Verschwörungsszenarien unterbunden oder in eine andere als die intendierte Richtung gelenkt.
Dass es manchmal schwierig ist, einen umstrittenen Sachverhalt ohne Verweis auf den bösen Anderen zu führen, ist auch unter MuslimInnen kein unbekanntes Phänomen der Kommunikation. Wie das beispielsweise aussieht, kann man in den Kommentarspalten der auch unter muslimischen WählerInnen recht beliebten Kleinpartei Team Todenhöfer ablesen. Dort hat sich eine klare Mehrheit neben schwammigen Verweisen auf „Militarismus“ und dem Übel des Krieges verständigt, dass die eigentlichen Verantwortlichen für den seit 24. Februar geführten Krieg nicht in Moskau, sondern eher in Washington – und jetzt auch in Berlin – sitzen. Problematisch daran ist nicht, auf gravierende Fehler und Mängel bundesdeutscher oder westlicher Außenpolitik zu verweisen. Vielmehr kann ein Whataboutismus in solch einer Konstellation dazu führen, einen Aggressor zur exkulpieren, der nicht in das bisherige Raster passt.
Am 27. Februar hat der muslimische Theologe und angehende Politologe Ibrahim Aslandur auf solche Reflexe in der muslimischen Kommunikation verwiesen. „Dieser ewige ‘Whataboutimus-Komplex’ unserer Community ist wahrlich zum Heulen“, schrieb er in einem Posting auf Facebook. Für ihn handle es sich dabei um einen spezifischen Typus: „Das sind Menschen, die im Geheimen die Destabilität der #Europäischen Union herbeiwünschen, weil sie voller Wut auf den #Westen sind. Das sind Menschen, die eine geschlossene #Solidarität für die #Ukraine zwar ‘gut’ finden aber dann irgendwie doch nicht, weil diese Art der #Solidarität nicht ihrer eigenen Herkunftsnation zugesprochen wird.“
Das ist eine harte Einschätzung, die umstritten ist. Dass es das Phänomen Whataboutism auch unter MuslimInnen gibt, dürfte angesichts der Beispiele unstreitbar sein. Ibrahim Aslandur geht es selbstredend nicht um die Frage, ob „der Westen“ kritisiert werden dürfe, sondern darum, dass Kritik nicht konstruktiv sei, solange sie einem „reflexartigem Muster“ folge. Es gäbe genug sinnvolle Fragen wie unsere Abhängigkeit von russischen Energieträgern, ob Aufrüstung eine probate Lösung sei oder ob die pathetische Floskel vom „Wandel durch Handel“ nicht gescheitert sei.
Aslandur ruft Muslime zur Rückkehr in eine rationale Debatte auf, anstatt dem einstudierten Mantra von „der-Westen-ist-heuchlerisch“ zu folgen. Eine Einsicht, der sich auch Linke-PolitikerInnen wie Janine Wissler angeschlossen haben: Der Konflikt habe eine Vorgeschichte, aber die aktuelle Eskalation sei dadurch nicht zu erklären.
Er erinnert uns daran, dass es nicht darum geht, den „Westen“ freizusprechen oder dass dieser „moralisch überlegen“ sei. Denn: „In der Politik geht es auch nicht um Moral, sondern um Macht, Sicherheit, Wohlstand, Wachstum und ähnliche Interessen. (…) Daher plädiere ich dafür, veraltete Mechanismen zu überwinden und sich dem Sachverhalt aus einer anderen Perspektive zu nähern, um einen wirklich konstruktiven Beitrag zum gegenwärtigen Diskurs zu leisten.“
Auch das kann angemerkt werden: Die Kritik am Interventionismus der letzten 20 Jahre war richtig und folgerichtig am fundiertesten sowie lautesten im Westen selbst. Und das war nötig. Keine Frage. Hier aber besteht ein Unterschied: Es gibt in der „muslimischen Welt“ nicht an allen Orten eine vergleichbare kritische Kultur. Die Stimmen, die sich trauen, faschistoide Bewegungen wie Hamas oder Hisbollah zu kritisieren, sind vergleichbar leiser. Und das aus Gründen. Wer will schon als „Verräter“ ermordet werden? Oder wer hat den Mut, einem der autoritären Regime öffentlich zu widersprechen?

