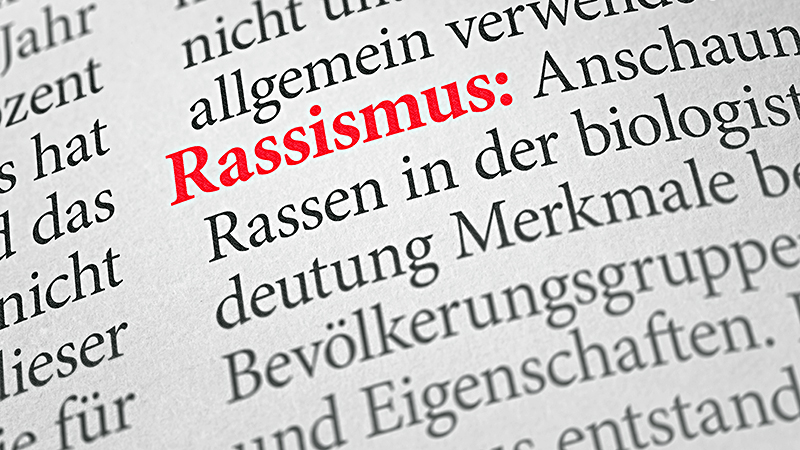Mehr denn je beschweren wir Muslime in Deutschland uns über diskriminierende und rassistische Erfahrungen. Ein Essay mit wichtigen Fragen und Erkenntnissen, die überraschen könnten.
(iz). Und es hat niemanden überrascht, dass diskriminierende und rassistische Vorfälle gegenüber Muslimen in Deutschland zugenommen haben und immer noch zunehmen. Wir fühlen uns als Opfer. Von Azizah Seise & Ahmet Aydin
Die Kommentarspalten in den Sozialen Medien sind voll von Angst, Hilflosigkeit, aber auch Ärger, Wut und Zorn über diesen Zustand. Die Schuld liege ganz klar bei den Anderen, den Bio-Deutschen, den Almans, den Kartoffeln, den Nazi-Enkeln. So lassen wir uns über unsere Mitmenschen aus und scheren selbst alle über einen Kamm.
Claudia Azizah: Es ist einige Jahre her. Ich stehe in Dresden an einer Strassenbahnhaltestelle, zusammen mit meinem Mann und dem Kinderwagen. Ich trage Kopftuch. Ein älterer Mann läuft vorbei. Sieht mich an und spuckt ohne Vorwarnung in meine Richtung. Er trifft mich. Galt dieser Angriff mir?
Ahmet Aydin: Ich bin als Gästebetreuer tätig. Ein Gast spricht mich auf die niedrigeren Löhne im Osten Deutschlands an. Ich sage ihm, dass ich mich mit den Unterschieden nicht beschäftigt habe. Plötzlich sagt er: „Ach komm, Du bist doch auch Ausländer.“ Will er mir sagen, dass ich, wie Menschen aus dem Osten, benachteiligt werde?
Claudia Azizah: Ich bin 17 Jahre alt und laufe durch mein Wohnviertel in Leipzig. Ich bin noch nicht Muslimin, falle mit meiner Kleidung trotzdem auf. Ich bin ein Hippie, trage bunte Sachen und lange offene Haare. Es ist November und um 18 Uhr schon dunkel. Ich laufe von der Haltestelle nach Hause und treffe auf eine Gruppe von jungen Neo-Nazis mit Bomberjacke, Springerstiefeln, Glatze und jungen Frauen mit kurzen Haaren. Ich kenne diese Menschen nicht. Eine dieser Frauen tritt auf mich zu und schreit mich ohne Vorwarnung an, beschimpft mich. Dann holt sie aus und verpasst mir eine schallende und schmerzhafte Ohrfeige. Die jungen Männer in der Gruppe halten sie zurück: „Diese Schlam… ist es nicht wert.“ Sie ziehen die Frau weiter. War das Diskriminierung aufgrund meines Äußeren? Galt dieser Angriff mir?
Ahmet Aydin: Es ist die Zeit nach 2015. Unzählige Menschen flüchten aus Syrien. Deutschland nimmt eine beachtliche Anzahl auf. Ich bin an einem Bahnhof und sehe, wie viele geflüchtete Menschen dort sitzen und in Schlafsäcken liegen. Die Polizei ist präsent und kontrolliert Pässe und Ausweise. Ich sehe wie vor mir zwei Punks, so nannte man sie in meiner Schulzeit, kontrolliert werden und will intuitiv meinen Ausweis hervorholen. Ich schaue, wo mein Portemonnaie ist, in meiner Brusttasche oder in meiner Tasche. Ich finde es nicht. Die Polizisten schauen mich an und winken mich weiter. Ich müsse nicht kontrolliert werden. Ich wurde in der Vergangenheit öfter für einen Syrer gehalten. Wieso wurde ich das in dieser Zeit nicht, obwohl eine Kontrolle nachvollziehbar gewesen wäre?

Foto: mpix-foto, Adobe Stock
Claudia Azizah: Ich sitze mit meinem nicht-deutschen und nicht-europäisch aussehenden Mann in der Ausländerbehörde. Wir werden von der Sachbearbeiterin aufgerufen. Sie scheint schlecht gelaunt zu sein, ist unhöflich. Die Art, wie sie unsere Ausweispapiere zum Identitätsabgleich fordert, hinterlässt ein ungutes Gefühl im Magen. Ich habe Angst: Was ist, wenn sie meinem Mann den Aufenthaltstitel verwehrt? Darf sie das? In meinem Kopf ist Kopfkino. Hat sie mich gerade missbilligend angeschaut? Vielleicht wegen meines Kopftuches? Ich gebe ihr meinen Ausweis. Sofort ändert sich ihre Stimmung. Auf einmal ist sie freundlich, fast zuvorkommend. Lag das an meinem Doktortitel, der auf dem Ausweis vermerkt ist? Wie wäre der Termin ohne diesen Titel verlaufen? War ich nur zu aufgeregt und deshalb überempfindlich, was mögliche negative Energien betrifft? Oder war es doch an der Grenze zu einer Diskriminierungserfahrung?
Ahmet Aydin: Die Augen beginnen zu strahlen, wenn ich sage, dass ich Germanistik und Philosophie studiert habe. Sowohl bei Menschen, die deutsch aussehen, als auch bei Menschen, die ausländisch aussehen. Einmal war ich an der Kasse im Supermarkt. Die Kassiererin trägt kein Kopftuch, aber sieht ausländisch aus. Die Person vor mir in der Schlange, mit Kopftuch, spricht gebrochen Deutsch. Die Kassiererin schimpft über ihr schlechtes Deutsch. Dann blickt sie mich an und sagt: „Aber Sie können Deutsch.“ Ich bin wütend darüber, wie sie die Person vor mir behandelt hat und antworte bewusst herablassend: „Ja, ich habe es studiert. Also besser als Sie!“ Die Kassiererin schaut mich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an, wenn ich im Supermarkt bin. Bekämpfen sich Menschen, die ausländisch aussehen, um von Deutschen geliebt zu werden?
Claudia Azizah: Oft besuche ich die ostdeutsche Kleinstadt, wo meine Großmutter wohnt. Erst seit einigen Jahren gibt es dort wenige Muslime oder als Muslime gelesene Menschen. Als Frau mit Kopftuch war und bin ich dort immer ein „Hingucker“. Gucken die Menschen böse, missbilligend, herablassend? Schauen sie rassistisch, hasserfüllt? Ich wag es nicht zu sagen. Das wäre meine Interpretation. Ich weiß, dass meine ostdeutschen Landsleute häufig nicht gerade den freundlichsten Blick haben. Das liegt nicht an mir und nicht am Kopftuch. Sie schauen einfach oft grummelig, schlecht gelaunt. Würde man ihnen einen Spiegel vorhalten, wären sie wahrscheinlich selbst erschrocken. Interessant ist, dass ich nie eine negative Reaktion auf ein freundliches „Guten Tag“ oder ein lächelndes Nicken bekommen habe. Im Gegenteil. Man kommt sogar ins Gespräch und das Stück Stoff auf dem Kopf guckt sich weg. Welche Erfahrung würde ich machen, wenn ich ähnlich gucken würde wie sie? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich ihren Blick auf mich bezöge?
Ahmet Aydin: In Deutschland lächeln die Menschen nicht so häufig. Das bestätigen Italiener oder Spanier auch. Früher dachte ich immer, „die“ Deutschen lächeln nicht, weil ich ausländisch aussehe. Dann sagte mir ein Rabbiner, der ziemlich deutsch aussieht, dass es in Deutschland einfach so ist. Die Menschen merken das gar nicht. Ich hatte es aber oft darauf bezogen, dass ich ausländisch aussehe und sofort Rassismus attestiert. Schaffe ich mir durch meine eigenen Gedanken so das Ungeheuer, über das ich mich im Anschluss rechthaberisch beklagen will? Würde ich die Ungeheuer des Rassismus einschläfern, wenn ich schöner von meinen Mitmenschen denken würde? Oder kann ich das nur sagen, weil ich kein Kleidungsstück trage, das fremd anmutet? Liegt es an meinem Äußeren, wie ich behandelt werde oder an meiner Sprache? War zuerst das Ei da oder das Huhn? Wie schickt es sich Menschen, und seien sie noch so rassistisch, zu behandeln?

Foto: Prostock-studio, Shutterstock
Das sind unsere Erfahrungen. Die Erfahrung einer deutschstämmigen Muslimin und eines türkischstämmigen Muslims in Deutschland. Warum erfahren wir als muslimische Gemeinschaft mehr und mehr Diskriminierung, ja sogar Rassismus? Es ist ein realexistierendes Phänomen. Das können wir nicht abstreiten.
Doch ist es sehr wichtig zu verstehen, dass alles, was wir erfahren und erleben, jede Ungerechtigkeit, die wir von anderen Menschen erfahren, letztendlich von Allah kommt. Das möchten wir oft so nicht wahrhaben. Doch alles kommt von Allah. Die anderen Menschen sind ein Werkzeug für das, was uns widerfahren soll und was seit Urzeiten geschrieben steht. Das macht es auf keinen Fall gut. Diskriminierung und Rassismus sind schlecht und wir müssen das Schlechte als solches benennen.
Gleichzeitig sollten wir überlegen, was wir daraus lernen können. Wir müssen Innenschau halten. Ist Diskriminierung und Rassismus in unseren muslimischen Gemeinschaften abwesend? Hält uns Allah gar einen Spiegel vor? Sind für uns wirklich alle Muslime gleichwertig? Oder blicken wir auf den schwarzen Bruder aus Afrika herab? Sind Sie empört das zu lesen? Oder ist der asiatische Bruder doch nicht passend für unsere türkischstämmige Tochter, obwohl er Hafiz und ein gottesfürchtiger und rechtschaffener Muslim ist? Sind Sie empört das zu lesen? Oder ist der türkischstämmige Muslim unwürdig für unsere Tochter, weil er kein Arabisch spricht? Sind Sie empört das zu lesen? Sind das nicht Beispiele aus der muslimischen Realität heutzutage?
Nur Allah weiß, ob es zwischen unserer eigenen diskriminierenden und rassistischen Einstellung und unseren Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung eine Korrelation gibt. Das maßen wir uns nicht an zu beurteilen. Jedoch sollte uns, als Muslime in Deutschland, bewusst sein, dass die Opferrolle keine gute Rolle ist. Wir müssen Unrecht verurteilen und strafrechtlich verfolgen, ja. Es darf uns jedoch auf keinen Fall lähmen, darf nicht unseren guten Charakter verändern, unsere Freundlichkeit in Hass verwandeln.
Allah sagt im Qur’an: „Allah wird den Zustand einer Gesellschaft nicht ändern, bis sie sich selbst ändern.“ (Ar-Ra’d, Sure 13, 11). Können wir uns selbst, unser Inneres ändern und verbessern, um unsere gesellschaftliche Situation in Deutschland zu ändern und zum Guten zu wenden? Lehnen wir die von Allah erschaffenen schlechten Taten ab und wählen die guten Taten? Wir haben als Menschen die Wahl.