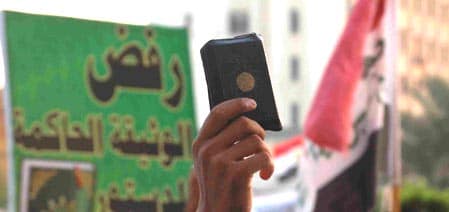(iz). Dem Dichter – wie dem gesamten Berufszweig der „Intellektuellen“, wird im Feuilleton und auf Festveranstaltungen gerne ein gewisser Respekt erwiesen. Oft genug verharren viele, nicht alle, in diesem Bannkreis, oder nehmen als sprachliche Kunsthandwerker am allgemeinen Spektakel teil. Wollen sie mit relevanten Beiträgen an Debatten teilnehmen, bleiben sie – jenseits des Feuilletons – zu oft ungehört oder, wie der Fall Grass belegt, werden von der Herde niedergebrüllt und schnell in ihre Reihen zurückgedrängt.
Zu den, existierenden, Ausnahmen gehört der deutsche Schriftsteller, Publizist und Drehbuchautor Feridun Zaimoglu, der sich neben seiner künstlerischen Tätigkeit auch an verschiedenen Debatten zu den Themen Islam und Integration beteiligt. Der Kieler (geb. 1964) war auch anfänglich Teilnehmer der Deutschen Islamkonferenz, die er aber 2007 wieder verließ. Aus Protest, dass keine selbstbewussten Muslimas mit Kopftuch eingeladen wurden.
Feridun Zaimoglu, der auch unter jungen Muslimen seine Leser findet, lässt sich nicht auf ein Genre oder auf ein bestimmtes Image festlegen. Schon gar nicht auf das Ökotop einer wie auch immer gearteten „Migrantenliteratur“. Mit dem aktuellen Titel „Ruß“ hat er einen „Heimatroman“ geliefert, der in der – eigentlich untergegangene – Welt des Ruhrgebiets spielt. Mit ihm sprachen wir unter anderem über den Fall Grass, die Möglichkeiten des Dichters und den Islam in Deutschland.
Islamische Zeitung: Lieber Feridun Zaimoglu, man hat den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Wirken der Dichter ins folgenlose Feuilleton oder in die kunsthandwerkliche Behübschung herrschender Verhältnisse abgeschoben wurde. Scheinbar plötzlich debattierte Deutschland tagelang über ein Gedicht – lassen wir dessen sprachlichen Gehalt einmal beiseite – von Günter Grass zur Kriegsgefahr im Nahen Osten. Hat sie das überrascht?
Feridun Zaimoglu: Mit Grass verfährt man, als hätte er sich des heimlichen Kackens im Weingarten des Herrn schuldig gemacht. Die Freaks der Aufklärung sahen in Sarazin einen ehrenwerten Mann mit kleinen Macken. Die selben Leuten hacken heute auf Günter Grass ein. Er hat die Konservativen geärgert, das verzeihen sie ihm nicht. Einige gute Leute aus dem Kulturjournal machen mit – weshalb? Grass’ Text ist eine einwandfreie politische Analyse. Die blinden Parteigänger mögen noch so laut jodeln: Günter Grass tat Wahrheit kund.
Islamische Zeitung: Früher waren Dichter Künder des Überzeitlichen und sollten Wahrheit sprechen? Lässt sich heute – nach Jahrzehnten Postmoderne, Dekonstruktivismus und Popkultur – damit überhaupt noch etwas anfangen?
Feridun Zaimoglu: Die Party ist vorbei, die Kasper sammeln die letzten Pappbecher ein. Es hieß: Lasst uns so schön ausgebeutet Lieder singen. Es hieß: Der Bekenner ist nur ein schlechter Tänzer. Es hieß: Däumchendrehen und Faseln macht uns munter. Es hieß: Gut und Böse – was schert uns das? Und heute? Geschwätz, Geflüster und Gerüchte. Aber auch: Zerpflückt die Armen. Kapitalverkehr von unten nach oben. Die Rechten schwätzen von Denkverboten, immer dann, wenn sie den Menschen das Denken verbieten wollen. Alles Lügen hilft nichts – der Kapitalismus frisst alle Kinder.
Islamische Zeitung: Ihr Buch „Ruß“ hat einer unserer Autoren im letzten Juli als „einen deutschen Roman“ bezeichnet. Ist es für Schriftsteller schwierig geworden, sich unverstellt und verständlich mit ihren Umfeld auseinanderzusetzen?
Feridun Zaimoglu: Hierzulande galt es als schick, Schischi-Schreiber aus Amerika oder Frankreich voll toll zu finden. Es wurden aber auch Pflänzchen aus den Literaturinstituten gelobt. Deutsch war unfein und deutsche Welt unwelthaltig. Das hat sich, nur ein bisschen, geändert. Nun will man, nun wollen die Experten, besser hinsehen.
Man man sich ja über mich lustig: Der Mameluck macht auf überdeutsch. Ist mir egal. Ich sehe, dass es vor meiner Haustür keimt und gärt. Blöde wär’s, nicht darüber zu schreiben. Gott sei Dank, die öden Büchlein von Frolleins und Knäbchen sind aus der Mode gekommen. Es sind nicht wenige Kolleginnen und Kollegen bereit, deutsche Geschichten zu schreiben. Man achte auf die Dichtkunst aus dem Osten. Gute Dichter rücken an, und man wird sie nicht mit den üblichen Schaufenster-Ossis verwechseln können.
Islamische Zeitung: Neben – oder begleitend? – zu ihrer schriftstellerischen Arbeit haben sie sich seit Jahren in verschiedene „Integrations-“ und „Islamdebatten“ eingeschaltet. Gelegentlich drängt sich der Eindruck auf, dass mit den meisten Beiträgen nicht die Klarheit, sondern nur die Unübersichtlichkeit zunimmt. Haben sie die Hoffnung, hier einen Unterschied zu machen?
Feridun Zaimoglu: Man ruft mich an und bittet mich um meine Meinung. Man sitzt bei mir auf dem Sofa und drückt auf die Aufnahmetaste des Diktafons. Und manchmal melde ich mich als Salonfrontsau zu Wort. Ich bin ehrlich: Ich glaube nicht, dass ich mit wirklich klaren Beiträgen zum Thema glänze. Ich gelobe Besserung.
Islamische Zeitung: Ein deutscher Philosoph hat gesagt: „Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ‘ich’ sagen.“ Gehen ihnen die vielen Identitätsdebatten nicht auf die Nerven?
Feridun Zaimoglu: Sie sagen es. Ich hör’ schon nicht mehr hin. Vor anderthalb Jahren habe ich aufgehört, Zeitungen zu kaufen. Der mündige und interessierte Bürger – was ein Schwindel. Frühstückszeitungen im Hotel lese ich dann doch. Um festzustellen, dass sich nichts geändert hat. Zur Ichverortung neigen vornehmlich Menschen, die im Leben sonst nichts vorhaben. Identität? Albern.
Islamische Zeitung: Lieber Feridun Zaimoglu, sie haben sich, beispielsweise in einem Beitrag für die „Zeit“ und in einer Interviewreihe mit den „Deutsch-Türkischen Nachrichten“, zu Wort gemeldet. Und zwar mit einer gehörigen Portion Wut. Braucht es diese Wut, um sich einen Weg zu den Herzen und zum Verstand der Menschen durchzuhämmern?
Feridun Zaimoglu: Was war noch einmal das Modewort der letzten Saison? Wutbürger. Was hat’s gebracht. Was bin ich? Schreibender Wutbürger. Schön ist es, sich nicht zu verheben. Ich rumpele in der Kiste, ein paar Freunde rufen an, und sagen: Guter Rappel, toll. Eigentlich liebe ich Zimmerlautstärke – ausgerechnet ich, den man auch gerne mal als altdeutschen Krakeeler bezeichnet. Ja, ich tobe. Ja, ich lange zu. Aber wenn ich schreibe, tauche ich ab und halte den Mund. Dann fühle ich mich am wohlsten. Das Reden über Missstände zermürbt. Trotzdem: Man sollte schon dann und wann die Lügner anbrüllen.
Islamische Zeitung: Sie nahmen an den ersten Runden der Deutschen Islamkonferenz teil. Können sie heute, nach mehreren Jahren und Mutationen dieser Gesprächseinrichtung, noch etwas damit anfangen? Wenn nein, sehen sie Alternativen?
Feridun Zaimoglu: Am Anfang stand die gute Idee: Die Moslems gehören zu Deutschland. Ich gehörte zu einem bunt zusammen gewürfelten Haufen aus Hauptberuflichen und Privatinteressierten. Es wurden viele Gruppenfotos geschossen. Das Ding implodierte. Der Stifter der Konferenz wanderte in ein anderes Ressort, die folgenden Minister sprachen weise Worte oder blödes Zeug. Heute schart man sich um eine Leiche, ringt die Hände. Die Leiche stinkt, man sollte sie begraben. Alternativen? Neue Moslem-Welle? Bund der aus der Konferenz Vertriebenen? Liberale für mehr Beinfreiheit? Nein. Junger Deutscher Islam. Ja.
Islamische Zeitung: Ein nicht unerheblicher Anteil der muslimischen Jugend hat höchstwahrscheinlich nur einen sehr begrenzten Zugang zur Sprachwelt und zur Literatur Deutschlands, aber auch der Kultur ihrer Eltern. Haben sie die Hoffnung – wenn sie das denn wollen – diese neuen Generationen zu erreichen?
Feridun Zaimoglu: Die meisten Deutschstämmigen haben keinen Bezug zu Literatur. Ich mache ja nur ein Angebot. Es fällt aber auch, dass zu meinen Lesungen immer mehr Muslime kommen. Sie erleben einen Berserker auf der Bühne. Manchen gefällt’s, andere rümpfen ob meiner Stubenbarbarei die Nase. In der Arbeiterklasse hält man halt die Kultur für recht verzichtbar. Auf die Techniken der Verfeinerung pfeift man. Sehr schade.
Islamische Zeitung: Was ist ihr Verhältnis zu den – vermeintlichen – sozialen Netzwerken und deren Folgen für unsere Kommunikation? Haben sie eine Bedeutung für ihren Alltag?
Feridun Zaimoglu: Verstehe die Frage nicht wirklich. Halt, doch mir dämmert’s. Bin Einzelgänger und Einzeltäter. Bin gern unter Menschen, setze mich aber auch gerne ab. Die meiste Zeit des Tages sitze ich alleine zu Haue, oder im Zug, oder im Hotelzimmer. Und brüte: über eine Geschichte, über den nächsten Roman, über das nächste Projekt. Und danke am Ende des Tages dem Allmächtigen, dass er mich geschützt hat.
Islamische Zeitung: Lieber Feridun Zaimoglu, wie sehen sie den Zustand der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland und was sollte geschehen, um ihn zu transformieren?
Feridun Zaimoglu: Alles ist in Auflösung. Schön. Alles ist im Entstehen. Noch besser. Das Ziel: Weg von der Tradition, vom Altvaterglauben. Hin zur Menschenliebe. Wer andere Menschen demütigt, ist ein Schwein. Ein Schwein muss man befehden. Das Heilige ist uns überliefert – daran festhalten. Und in den Gärten der reichen Säcke heimlich kacken – darauf nicht verzichten.
Islamische Zeitung: Lieber Feridun Zaimoglu, wir danken Ihnen für das Gespräch.