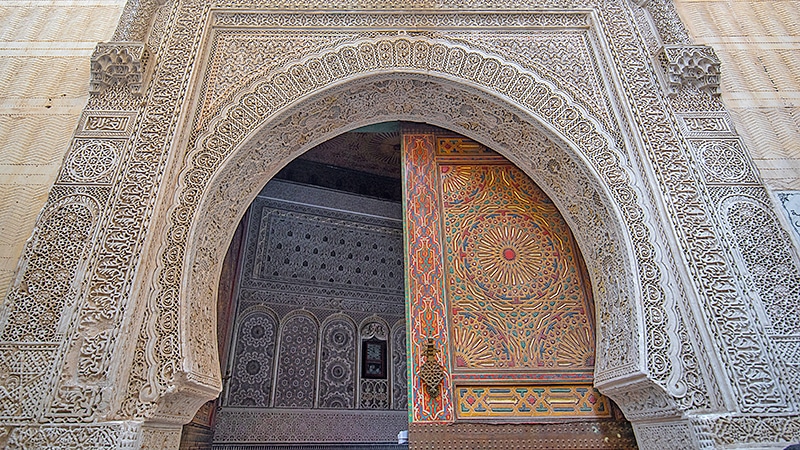(iz). Mouhanad Khorchide unterstellt mir [sowie der Redaktion der Islamischen Zeitung, Anm.d.Red.] in einem Interview, das vor Kurzem auf der Online-Plattform www.islam.de veröffentlicht wurde, ein „lebensfeindliches Verständnis“ des Islam zu propagieren und im Sinne der Salafisten zu polarisieren.
Ich wollte – so Khorchide – gemeinsam mit den Salafisten nicht, dass der Islam mit Barmherzigkeit in Verbindung gebracht wird und hätte behauptet, dass die theologischen Thesen von Khorchide meilenweit von der muslimischen Basis entfernt seien. Zu diesen Vorwürfen und Unterstellungen nehme ich folgendermaßen Stellung:
Befremdliche Vorwürfe eines Hochschullehrers
Bis auf den letzten Punkt entspricht nichts von dem weder meiner persönlichen Position, noch der meiner Religionsgemeinschaft, der Schura Niedersachsen. Dies sind einseitige Unterstellungen und befremdliche Vorwürfe eines Hochschullehrers, der anscheinend nur sich selbst und seine Theologie für lebensfreundlich hält. Wer jedoch den „Spaß am Leben“, wie es Khorchide selbst formuliert, gegen islamische Grundwerte und Normen definieren möchte und dadurch die Religion zur Beliebigkeit degradieren will, muss dies offen bekunden. Ich habe so wenig mit den Salafisten zu tun, wie die Theologie von Khorchide selbst mit dem islamischen Mainstream und der muslimischen Basis in Deutschland zu tun hat.
Randständige Positionen
Von einem Beamten, der mit staatlichen Geldern finanziert wird und glaubt islamische Theologie zu betreiben, wäre jedoch zu erwarten, dass er die islamischen Glaubensgrundsätze beachtet, wenn er die künftigen Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht und die Imame (allgemeiner Religionsbedienstete) für die Moscheegemeinden ausbilden möchte. Dies ist keine Zumutung und auch keine Positionierung gegen die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, sondern eine Selbstverständlichkeit im weltanschaulich-neutralen Staat. Denn seine unseren Glaubensüberzeugungen widersprechenden normativen Hypothesen kann er im universitären Rahmen sehr wohl auch in der Islam- oder Religionswissenschaft lehren und darlegen, womit wir keinerlei Probleme hätten. Wer jedoch A sagt muss auch B sagen, der Anspruch islamische Theologen auszubilden, geht mit dem Wagnis einher sich nicht nur auf die Glaubensgrundsätze der Muslime einzulassen, sondern diese auch zu verinnerlichen und zu teilen. Seine randständigen Positionen als den unverfälschten Islam im wahrsten Sinne des Wortes zu verkaufen und die Repräsentanten der islamischen Religionsgemeinschaften als lebensfeindlich zu deklarieren, übertrifft jede Form von Dreistigkeit.
//2r//Nicht nur ich selbst, sondern viele andere exponierte Vertreter der Muslime in Deutschland haben sich von den Positionen Khorchides distanziert und diese kritisiert. Neben Ditib Nord, haben sich Vertreter von Schura Hamburg und auch Ditib Hessen ausdrücklich von seinen Thesen abgegrenzt und ihr Befremden zum Ausdruck gebracht. Auch Ditib-Sprecher Bekir Alboga hat diese Thesen verurteilt und sich sehr irritiert darüber gezeigt.
Kritik wird als „unwissenschaftlich“ diffamiert
Da Khorchide jede Kritik an seinem veröffentlichten Buch als unislamisch und unwissenschaftlich bezeichnet, möchte ich klarstellen, dass ich hier lediglich auf die von ihm veröffentlichten und mit großem Wohlwollen der nichtmuslimischen deutschsprachigen Presse unterstützten Positionen lediglich reagiere und hierzu Position beziehe. Er durfte in den wichtigsten Presseorganen dieses Landes in der nichtmuslimischen Öffentlichkeit massiv für sein Buch werben und wurde hierbei systematisch und gut organisiert unterstützt. Selbst das Bundesforschungsministerium wirbt mit seinem Namen deutschlandweit auf Plakaten und baut ihn damit offenkundig als modernen, aufgeklärten Theologen bewusst auf. Von einer neutralen Positionierung der nichtmuslimischen Medien und staatlichen Stellen in Bezug auf rein religiöse Glaubensdiskurse ist hier wenig zu verspüren und Khorchide kann sicherlich keine fehlende Unterstützung für seine Thesen durch die Medien beklagen. Im Gegenteil, selbst die Reaktionen der nichtmuslimischen Pressevertreter (Qantara, TAZ, Deutschlandfunk etc.) auf einen theologischen Diskurs zwischen den Muslimen (Reaktion der Ditib Nord, Schura Hamburg, Ditib Hessen versus Khorchide) war massiv parteiergreifend für Khorchide. Zudem veröffentlicht man ein Buch um seine Gedanken zu verbreiten und damit hat man nicht nur positive Rückmeldungen von Vertretern der Nichtmuslime oder säkularer Kulturmuslime zu erwarten, sondern muss im öffentlichen Diskurs auch mit Kritik von bekennenden und praktizierenden Muslimen und ihrer Religionsgemeinschaften rechnen.
„Jede Politisierung der Theologie durch die Hintertür lehnen wir strikt a2b
Unsere Aufgabe als Vertreter eben dieser islamischen Religionsgemeinschaften ist es gerade diese Entwicklungen an staatlichen Hochschulen kritisch zu begleiten um einen Staatsislam im Zuge der universitären Ausbildung zu verhindern und dem weltanschaulich neutralen Staat, der durch die Universitäten agiert, seine Grenzen im theologischen Bereich aufzuzeigen. Jede Politisierung der Theologie durch die Hintertür lehnen wir strikt ab und werden uns hiergegen mit rechtsstaatlichen Mitteln wehren. Hochschullehrer sind verwaltungstechnisch den Universitätsrektoren untergestellt, die wiederum nicht nur durch das Wissenschaftsministerium finanziert werden, sondern auch als oberstem Dienstherren diesen unterstehen. Der Staat ist nach den Vorgaben des Grundgesetzes nicht berechtigt über Hochschullehrer, die Beamte des Staates sind, Glaubensüberzeugungen von Religionsgemeinschaften zu konstituieren oder diese einseitig gegen ihren ausdrücklichen Willen paternalistisch weiter zu entwickeln. Alles andere würde zu einer Staatskirche führen, was unserem Grundgesetz eindeutig widerspricht.
//3l//Meinungsvielfalt in einem bestimmten Rahmen wurde im Islam immer durchaus positiv bewertet. Die von nahezu allen sunnitischen, schiitischen, mutazilitischen etc. Gelehrten geteilten Glaubensüberzeugungen jedoch als salafistisch zu bezeichnen (vgl. beispielsweise S. 216-217 in seinem Buch) und dadurch diskreditieren zu wollen, entspricht weder einem differenzierten wissenschaftlichenUmgang, noch ist dies guter muslimischer Brauch.
Mir persönlich als Anhänger der mystisch geprägten Nurculuk-Bewegung eine Nähe zum Salafismus vorzuwerfen, zeugt gleichzeitig von jedweder Unkenntnis der islamischen Bewegungen in Deutschland. Dies bedaure ich umso mehr, da Prof. Khorchide Leiter eines Zentrums für Islamische Theologie an einer bedeutenden deutschen Universität ist und den Unterschied zwischen der Nurculuk-Bewegung und dem Salafismus kennen sollte.
Mehrfach hat sich die Schura Niedersachsen, wie auch ich selbst öffentlich von dem Salafismus distanziert und diesen kritisiert. Gegenüber der salafistischen Theologie habe ich ähnliche Bedenken, wie ich sie gegenüber den Thesen von Khorchide ebenfalls habe. Da Khorchide mittlerweile sehr gut in der deutschen Presselandschaft vernetzt ist, hätte er wenigstens diese Meldungen zur Kenntnis nehmen können, bevor er mir über die konservative Schiene eine Nähe zum Salafismus vorwirft. Zudem vertritt die Schura Niedersachsen in diesem Bundesland seit fast 15 Jahren – mit Ausnahme der Salafisten – unabhängig von ethnischer und konfessioneller Zugehörigkeit oder Rechtsschule beinahe alle Moschee-Gemeinden außer den Ditib-Gemeinden, die eigenständig organisiert sind.
Um was geht es genau bei meiner Kritik? Warum distanziere ich mich von seinen Hypothesen? Ich habe vor Monaten in einem Interview gesagt, dass Khorchide mit diesem Buch die Erwartungen der Residenzgesellschaft bedient und mit viel Zuspruch der Nichtmuslime rechnen darf, seine Hypothesen jedoch meilenweit von der muslimischen Basis entfernt sind. Folgende Textstellen aus seinem eigenen Buch belegen in der gebotenen Kürze seine marginalen islamisch-theologischen Positionen, die ich nicht nur ablehne, sondern auch für höchst problematisch mit Blick auf die Entwicklung der islamischen Theologie in dieser Gründungsphase an staatlichen Universitäten erachte. Die islamische Theologie ist in Deutschland noch ein zartes Pflänzchen zugleicht gibt es auf muslimischer Seite große Vorbehalte und Bedenken gegen diese universitäre Ausbildung, die wir als islamische Religionsgemeinschaften täglich zu entkräften versuchen. Hervorheben möchte ich auch folgendes: Für eine authentische und glaubwürdige Entwicklung der islamischen Theologie in einer christlich und säkular verfassten Gesellschaft, in der die Muslime eine kleine Minderheit sind, empfinde ich für mindestens so besorgniserregend, wie diese wissenschaftlich eingekleideten Glaubensüberzeugungen von Khorchide, die externe, bevormundende Einmischung von Nichtmuslimen in diesen rein religiösen DiskurS.
Nach Khorchide ist beispielsweise Gott im christlichen Duktus nichts anderes als die Liebe und Barmherzigkeit per se. S. 199 Damit reduziert er Gott auf ein niedliches, harmloses Wesen und relativiert, ja negiert zahlreiche eindeutige weitere strafende und ausgleichende Attribute, Eigenschaften und Namen Allahs, die der Selbstbeschreibung Gottes und seines Propheten in Koran und Sunna entsprechen. „Unter den Menschen gibt es manch einen, der ohne Wissen über Gott zu haben, über ihn streitet und dem aufrührerischen Teufel folgt.“ Koran 22/3 Im folgenden Textabschnitt möchte ich mit unmissverständlichen und klaren Zitaten aus dem Buch von Khorchide seine Standpunkte skizzieren, damit jeder Leser sich sein eigenes Bild machen und Urteil bilden kann.
//4r//Glaube und Gottesvorstellungen nach Khorchide
Nach Khorchide sind Glaubenszugehörigkeiten billige Überschriften und Etikettierungen, die für das Jenseits unbedeutend sind. Muslime sollen sich Gott nicht unterwerfen und ihm dienen, da dies nur ein restriktiver Diktator verlangen könne. Jeder Muslim soll selbst individuell entscheiden, ob und wie er eine Beziehung zu Gott aufbaut und diesen dann eigenständig verantworten. Gott in Gehorsam zu dienen schalte nach Khorchide die Vernunft ab und verdamme den Menschen zur Unmündigkeit. Der Mensch sei aber zu mehr berufen, als zum Knecht (ibada, türkisch kulluk) sein. Diese vereinfachenden Thesen alleine widersprechen den Glaubensüberzeugungen sämtlicher Madahib. „Ich fragte mich nach dem Sinn und Zweck von Religion. Was will Gott von uns Menschen eigentlich? Und was will dieser Gott für sich? Warum überhaupt das Ganze? Wie kann es sein, dass dieser Gott Menschen, die ungerecht sind und andere Menschen abfällig behandeln, ins Paradies eingehen lässt, andere aber, die gerecht sind und andere Menschen respektvoll behandeln, für immer in die Hölle verbannt? Weil sie die falsche Überschrift tragen?! Weil sie sich nicht Muslime nennen?! Geht es Gott wirklich nur um Überschriften?! Geht es Gott wirklich nur darum, dass an ihn geglaubt wird? Geht es ihm darum, dass nur auf eine bestimmte Art und Weise an ihn geglaubt wird? Geht es Gott also um sich selbst? Braucht er uns, um von uns angebetet zu werden, hat er uns deshalb erschaffen? Wer sich ihm also unterwirft, den belohnt er mit dem Paradies, und wer sich ihm nicht unterwirft, dem zeigt er im Jenseits, wer das letzte Wort hat, wer der Chef ist? Geht es Gott wirklich darum, seine Macht zu demonstrieren? Ist Gott wirklich so klein? Ich kam zu der Antwort: Mit Sicherheit nicht! Gott ist kein Diktator, kein Mubarak oder Gaddafi. Gott ist in sich vollkommen.“ (S. 25)
„Die Beziehung des Menschen zu Gott wird auf eine Dimension reduziert, nämlich die des GehorsamS. Gehorsame werden für ihren Gehorsam belohnt, Ungehorsame entsprechend bestraft. Die Fähigkeit des Menschen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, Gotteserfahrungen zu machen und diese zu reflektieren, eine individuelle Beziehung zu Gott aufzubauen, eine eigene Religiosität zu entwickeln und diese selbst zu verantworten, für sich selbst zu entscheiden, wie er sein Leben entwerfen und auf Gott individuell ausrichten will – all das wird ignoriert und unterdrückt. Wäre es aber nicht unfair von Gott, uns eine Vernunft zu geben, die verstehen will, die viele Fragen hat und vieles hinterfragen will, die dem folgen will, was ihr einleuchtet, was sie nachvollziehen kann – aber zugleich von uns zu erwarten, diese Vernunft zu unterdrücken? Ist dann Vernunft eine Falle, die Gott dem Menschen gestellt hat, um zu sehen, ob er sich für das blinde Gehorchen oder das kritische Reflektieren entscheidet? Spielt Gott die Vernunft gegen sich selbst aus? Ist die Vernunft der Hauptfeind des Menschen? Ist das menschliche Leben ein einziger Kampf gegen die eigene Vernunft? Sind diejenigen Sieger, die sich für Gott und gegen die Vernunft entschieden haben, und die Verlierer, die sich zur Vernunft und gegen Gott gewandt haben?! Viele Gelehrte spielen Gott gegen die Vernunft auS. Sie stellen die Menschen vor die Wahl: entweder Gott oder die Vernunft. Diese Position wird weder Gott noch der Vernunft gerecht. Beide gehen dadurch verloren. Aus Gott wird ein selbstsüchtiger Diktator, und die Vernunft wird ausgeschaltet.“ (S. 74-75)
„Viele Muslime projizieren ihre Vorstellung von einem mächtigen Familienoberhaupt oder von einem archaischen Stammesvater, dem man unhinterfragt gehorchen und sich unterwerfen muss, auf ihre Vorstellung von Gott. Demnach gestaltet sich die Gott-Mensch-Beziehung als Beziehung zwischen einem Herrn und seinem Knecht. Der Herr braucht seinen Knecht, er ist auf seine Dienste angewiesen, um seine Herrlichkeit genießen zu können. Will aber Gott wirklich, dass Menschen ihm dienen? Braucht er unseren Dienst? Diese Vorstellung eines restriktiven Diktators, dem es nicht um die Interessen seines Volkes geht, unterscheidet sich kaum von der Vorstellung eines restriktiven Diktators, dem es nicht um die Interessen seines Volkes geht, sondern um die Unterwerfung der Menschen unter seinen Willen. Der Mensch ist unmündig, er ist auf die Instruktionen Gottes angewiesen. Der Koran und die prophetische Tradition werden in dieser Sichtweise als Instruktionen Gottes wahrgenommen, die Gott dem Menschen verkündet, da dieser nicht in der Lage sei, von sich aus zu erkennen, was gut und was schlecht für ihn ist. Der Koran und die Sunna (prophetische Tradition) sind demnach eine Art Bedienungsanleitung für das Funktionieren des Menschen.“ (S. 73)
„Manche Gelehrte interpretieren die islamische Religion so, als ginge es lediglich um die Verherrlichung GotteS. Sie berufen sich auf folgenden koranischen Vers: „Ich habe den Menschen erschaffen und den Dschinn (ein Geistwesen) nur deshalb erschaffen, damit sie mir dienen.“ (Koran 51/56) Dieses Verständnis von Religion kollidiert jedoch mit dem Verständnis, dass Gott den Menschen bedingungslos aus seiner Barmherzigkeit erschaffen hat, um seine Liebe mitzuteilen… .“ (S. 114)
Jenseitsvorstellungen nach Khorchide
Nach Khorchide sind die Höllen- und Paradiesvorstellungen des Korans kontextgebundene, historisch geprägte Aussagen, die die unterentwickelten Menschen im 7.Jahrhundert ansprechen. (S. 62-63)
Mündigen Muslimen gehe es „nicht um eine opportunistische Haltung, die lediglich darauf zielt, die eigene Haut vor dem Höllenfeuer zu retten (…)“, sondern um die Gemeinschaft mit Gott. (S. 218)
Allen andere unterstellt er Selbstanbetung. „Man belügt sich selbst, wenn man behauptet, man verehre Gott durch Beten und Fasten, man aber in Wirklichkeit nur in ein Paradies voller materieller Vergnügungen kommen möchte.“ (S. 62)
Geschickt schreibt er die verbreitete Wahrnehmung des Jenseits unter Muslimen neben den Mutaziliten lediglich den Aschariten zu, spricht bewusst nicht von den Sunniten und meint anscheinend dadurch verheimlichen zu können, dass seine Position zudem weder dem sunnitischen noch dem schiitischen Jenseitsglauben entspricht. Im Grunde widerspricht er damit dem Jenseitsbekenntnis aller bekannten islamischen Strömungen einschließlich der der Ahl as-Sunna, der Schia und der Mutazila etc.
„Der Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, sieht im Jenseits – anders als die Aschariten oder Mutaziliten tun – nicht nur ein Gericht, dessen Ziel es ist, Gerechtigkeit wiederherzustellen, sondern darüber hinaus eine Phase der Transformation, mit der die Menschen zur ewigen Glückseligkeit , also in die Gemeinschaft mit Gott gelangen, indem sie Gottes Barmherzigkeit in ihrer absoluten Vollkommenheit erfahren und erleben. (…) Gott hat großes Interesse daran, seine ursprüngliche Intention bei der Schöpfung – nämlich Mitliebende zu haben, die er in seine Gemeinschaft einschließt.“ (S. 50)
„Die Hölle ist demnach kein Ort der Bestrafung oder der Rache Gottes, sondern steht symbolisch für das Leid und die Qualen, die der Mensch im Laufe dieses Transformationsprozesses erlebt. Dabei begegnet er einerseits der unendlichen Barmherzigkeit und Liebe GotteS. Dies versetzt ihn in Scham und Demut, da ihm bewusst wird, dass er in seinem Leben Nein zu dieser Liebe und Barmherzigkeit gesagt hat.“ (S. 50-51)
„Der Versuch, das Jenseits als Ort der Vervollkommnung und Transformation des Menschen zu verstehen, soll keineswegs das wortwörtliche Verständnis von Paradies und Hölle als von tatsächlich existierenden Orten ersetzen, sondern denjenigen ein weiteres Interpretationsangebot bieten, die nicht aus Angst vor einer Bestrafung bzw. Hoffnung auf eine Belohnung Gutes tun und das Schlechte vermeiden, sondern, die bestrebt sind, sich in ihrem Menschsein zu vervollkommnen und selbstlos Gutes zu tun. Eine Lesart des Jenseits als Ort der Transformation macht den Menschen ein Angebot, Gott nicht als Richter zu erfahren, sondern ihn in seiner vollkommenen Barmherzigkeit zu erkennen. Wer sich aber nur dann bzw. besser in der Lage sieht, das Gute zu tun und sich vom Bösen abzuwenden, wenn er sich von einer jenseitigen Strafe bedroht fühlt bzw. auf eine Belohnung im Sinne materieller Vergnügung hofft, dem steht das Angebot, das Paradies und die Hölle als tatsächlich existierende Orte im materiellen Sinne zu verstehen, nach wie vor offen.“ (S. 56)
Religionsverständnis nach Khorchide
Der Autor stellt das ganze Konzept der Rolle und Aufgabe von Religion und der Welt als Ort der Prüfung auf den Kopf. Nach islamischem Glauben sendet Gott Propheten mit Büchern (religiösen Vorschriften) um die Menschen zum rechten Weg zu leiten. Gläubige Menschen sollen diese Glaubensüberzeugungen teilen und bestätigen und die Gebote, Verbote, Werte etc. akzeptieren und praktizieren. Nach Khorchide aber sei es eine „naive Vorstellung“ zu glauben, dass Gott Instruktionen schicke, „um zu sehen, wer sich an sie hält und wer nicht, um dann diejenigen, die ihm gehorchen, zu belohnen und sich an den Ungehorsamen zu rächen. Diese Vorstellung wird Gott in keiner Weise gerecht. Sie macht aus ihm einen Diktator, der nur auf Gehorsam aus ist, der verherrlicht werden will und nach Selbstbestätigung sucht. Die Beziehung zu solch einem `Diktator-Gott` kann nur auf Angst basieren.“ (S. 63-64)
„Der Gedanke Gott habe die Menschen erschaffen, weil er verherrlicht oder angebetet werden wolle, macht aus Gott einen von Minderwertigkeitsgefühlen geplagten, egoistischen `Diktator`, der auf der Suche nach sich selbst ist. Das ist dann aber nicht mehr Gott.“ (S. 70)
„Es geht beim Gottesdienst somit nicht um Gott, sondern um seine Schöpfung. Man dient Gott, indem man seiner Schöpfung dient.“ (S. 115)
//5r//Glaubensverständnis und das Jenseits für Nichtmuslime nach Khorchide
Nach Khorchide spielt es für das Jenseits keine Rolle, welcher Religion jemand zugehörig ist oder welche Glaubensüberzeugung er teilt. Im Grunde ist die Glaubensüberzeugung eines Menschen relativ unbedeutend, da es nach Khorchide alleine auf das Handeln ankommt. Jeder barmherzig und liebevoll handelnde Mensch ist als Medium Gottes Muslim, auch wenn er explizit formuliert nicht an Gott glaubt. Hierbei handelt es sich nicht um ein -wie von ihm behauptet- aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, vielmehr zieht sich dieser Gedankenstrang konsequent durch das ganze Buch. „Und wer den Glauben leugnet, dessen Werk-Handlung-Tat ist zunichte geworden. und im Jenseits gehört er zu den Verlierern.“ Koran 5/5.
„Der Gerichtstag als Ort der Abrechnung mit den ‚Ungläubigen‘ lässt hier auf der Erde ein Gefälle zwischen Muslimen und Nichtmuslimen entstehen. Muslime und Nichtmuslime können sich nach der Vorstellung der traditionalistischen islamischen Theologie nicht auf Augenhöhe begegnen, da, unabhängig von ihren jeweiligen Handlungen, heute schon feststeht, wer der ‚Gewinner‘ und wer der ‚Verlierer‘ sein wird. Gott aber interessiert sich nicht für Überschriften wie ‚Muslim‘, Christ‘, ‚Jude‘, ‚gläubig‘, ‚ungläubig‘ usw., Gott geht es um den Menschen selbst, um seine Vervollkommnung, damit er ihn für sich, für seine ewige Gemeinschaft gewinnen und ihn in sie aufnehmen kann. Entscheidend dabei ist, ob der Mensch dieses Angebot annimmt oder nicht. Die Hölle ist nichts anderes als der Zustand, in dem sich derjenige befindet, der Nein zu Liebe und Barmherzigkeit, der Nein zur Gottesgemeinschaft sagt.“ (S. 57-58)
„Die Vorstellung vom Gerichtstag als Ort der Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes und der Wahrheit des Menschen selbst bietet hingegen keine Grundlage für ein derartiges Machtgefälle zwischen den Menschen. Der Gerichtstag im Sinne einer Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes soll uns nicht in Schrecken versetzen, sondern uns hoffen lassen –und zwar alle, egal WELCHER RELIGION ODER WELTANSCHAUUNG WIR FOLGEN. Gott will letztendlich alle in seine Gemeinschaft aufnehmen, bis auf diejenigen, die Nein zu seiner Liebe und Barmherzigkeit, Nein zu seiner Gemeinschaft sagen. Er ist wie der liebende Vater oder die liebende Mutter, die ihren Kindern alles Liebe der Welt wünschen.“ (S. 59-60)
„Einige sagen: „Ich strenge mich die ganze Zeit an, vermeide diesen oder jenen Genuss im Leben, und am Ende ist Gott zu mir genauso barmherzig, wie zu denen, die alles genossen haben?!“ Dieses Argument bringt eine gewisse Unzufriedenheit mit zum Ausdruck: Man empfindet es als Last, nicht zu sündigen, man ist nicht ganz davon überzeugt, der Verzicht auf Sünden kommt nicht von Herzen. Ein Freund von mir, der in einem arabischen Land als muslimischer Gelehrter arbeitet, erzählte mir von einem Engländer, der mit sechzig Jahren den Islam annehmen wollte. Er ging zu einem Imam und fragte ihn, ob er den Islam annehmen könne. Der Imam verneint dieS. Der Engländer war sehr enttäuscht und kam nach langer Verzweiflung zu meinem Freund und stellte ihm dieselbe Frage. Mein Freund sagte ihm, natürlich könne er sofort zum Islamübertreten. Als mein Freund den Imam zur Rede stellte, sagte dieser: „Der Mann ist sechzig Jahre alt, er hat alles im Leben genossen, schöne Mädchen, Alkohol, und nun soll er mit mir ins Paradies kommen, der ich nichts davon gehabt habe, was er lebenslang genossen hat?! Das geht nicht!“ (S. 67-68)
//6l//Professorales Takfir
Salafisten und alle extremistischen Muslime gelten bei Khorchide nämlich als Kafir, die Nein zur Liebe und Barmherzigkeit Gottes sagen und damit direkt in die Hölle kommen. „Gerade Salafisten und andere Fundamentalisten und Extremisten, die im Namen ihres Glaubens Hass und Unfrieden auf Erden verbreiten, sind nichts anderes als kafirun.“ (S. 91)
„Der Mensch ist ein Medium der Verwirklichung göttlicher Liebe und Barmherzigkeit durch sein freies handeln. Gott und Mensch arbeiten Seite an Seite, um Liebe und Barmherzigkeit als gelebte Wirklichkeit zu gestalten. (…) Der Mensch, die die Einladung Gottes zu Liebe und Barmherzigkeit annimmt und bereit ist, ein Medium der Verwirklichung göttlicher Intention zu sein, ist ein Muslim. Islam ist die Annahme der Liebe und Barmherzigkeit GotteS. “ (S. 85)
„Ich möchte versuchen, eine Vorstellung vom Islam jenseits eines dogmatischen Verständnisses zu vermitteln, in dem es lediglich um die Frage nach den richtigen Glaubenssätzen geht. Fundamentalisten haben sich in der Frage verloren, woran ein Muslim glauben muss, und ihre Liste beschränkt sich keineswegs auf die sechs Glaubensgrundsätze (Gott, Engel, Bücher, Propheten, Wiederauferstehung und Vorherbestimmung), sondern es kommen noch viele Glaubenssätze dazu, wie der Glaube an die Rechtschaffenheit aller Gefährten des Propheten, der Glaube an die Fürbitte des Propheten am Tag des Gerichts, der Glaube an eine Brücke, die über die Hölle geht, der Glaube an die Schau Gottes im Jenseits, der Glaube an die Existenz einer Waage am Tag des Gerichts usw.“ (S. 86)
„Der traditionellen islamischen Lehre nach muss sich jeder Muslim und jede Muslimin zu den islamischen Glaubensgrundsätzen bekennen. Diese bilden die so genannte islamische `Aqida.“ (S. 209)
„Ein Verständnis von Glückseligkeit, dass diese lediglich von den richtigen Glaubenssätzen abhängig macht, hat sich bis heute mehr oder weniger umfassend durchgesetzt. Dieses Verständnis steht jedoch im Widerspruch zu den koranischen Aussagen.“ (S. 211)
„Die Verwirklichung von Gottes Liebe und Barmherzigkeit auf der Erde verliert ihre zentrale Bedeutung, wenn wir den Islam auf Glaubenssätze oder auf das Glaubensbekenntnis reduzieren. Nach der oben dargestellten Definition des Islam ist jeder, der sich zu Liebe und Barmherzigkeit bekennt und dies durch sein Handeln bezeugt, ein Muslim, AUCH WENN ER NICHT AN GOTT GLAUBT, denn Gott geht es nicht um die Überschriften `gläubig` oder `nichtgläubig`. Gott sucht nach Menschen, durch die er seine Intention, Liebe und Barmherzigkeit, verwirklichen kann; Menschen, die bereit sind, seine Angebote anzunehmen und zu verwirklichen. Und umgekehrt ist jeder, der meint, an Gott zu glauben, jedoch Liebe und Barmherzigkeit nicht durch sein Handeln bezeugt, kein Muslim.“ (S. 87-88)
Khorchide ist nicht nur mutig bei der Kritik der Glaubensgrundsätze der Muslime, vielmehr wirft er ihnen vor den Islam im Grunde seit Muawiya falsch verstanden und ausgehöhlt zu haben. Lediglich die Fassade der Religion des Propheten sei heute übrig geblieben. „Von dem Islam Muhammads“ sei „heute kaum etwas geblieben.“ (S. 212)
Praktizierter Islam = konservativ = „salafistisch“?
Schließlich etikettiert er mehr oder weniger die praktizierte Form des Islam in Deutschland mit konservativ und setzt diesen dem Salafismus gleich. „Wie konnte es passieren, dass sich einige dieser Positionen nicht nur in salafistischen Milieus verbreitet haben, sondern auch in anderen islamischen Kreisen, die man heute als „konservativ“ bezeichnet?! Ich wundere mich immer wieder über Muslime, die darauf beharren, dass Gott im Islam nicht der absolut Barmherzige ist sondern auch der zornige und der bestrafende Gott sei,, während der „liebende“ Gott der christliche Gott sei.“ (S. 216-217)
Für jemanden der das Glaubensbekenntnis hybridisiert und normativ diesen auf das barmherzige Verhalten verlagert, gleichzeitig die Höllenstrafen de facto negiert und verniedlicht, argumentiert er in dieser Kausalkette folgerichtig und plausibel. Und auch in diesem Gedankengang schließt sich nun der Kreis, da er mich persönlich zuvor auf www.islam.de als konservativen Vertreter des Islam den Salafisten gleichgestellt hatte, die er ja bekanntlich als kafir bezeichnet. Gleichzeitig braucht man nach unserem Autor kein Muslim im herkömmlichen Sinn zu sein, um ins Paradies und in die „Gemeinschaft Gottes“ zu kommen. Das Paradies des Koran steht nach Khorchide auch allen Christen, Atheisten etc. zu, nur nicht den Salafisten und allen ihnen gleichgestellten bösen konservativen Muslimen.
Abschließende Bewertungen
Ein Buch mit solch gewagten Thesen zu verfassen, verlangt von jedem Autor eine klare Vertiefung in die islamische Theologie und viel intensivere Auseinandersetzung mit der reichhaltigen islamischen Wissenschaftstradition voraus, als dies in diesem Buch geboten wird. Diesem Wunsch liegt freilich der Gedanke zu Grunde, dass auch diese Kompetenzen bei dem Autor vorhanden sind. Schließlich betont Khorchide immer wieder, dass er sein Buch als islamischer Theologe schreibt und ist bei seiner Kritik an die Muslime auch kein bisschen bescheiden oder demütig.
Wie ist es um die Qualifikation bestellt?
An dieser Stelle wäre nach der wissenschaftlichen Qualifikation von Prof. Khorchide zu fragen. Soweit ich informiert bin, hat er weder einen Master, noch eine Dissertation im Bereich der islamischen Theologie. Beide Abschlüsse hat er im Bereich der Soziologie und Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien zu Themen des islamischen Religionsunterrichts und der Integration erlangt. Die Suche nach einer Habilitation ist ebenfalls eine ganze Fehlanzeige.
Lediglich über einen B.A. Fernstudium einer Universität in Beirut verfügt unser Autor. Zudem hat Dr. Khorchide keine Professur im Bereich der Kerndisziplinen der islamischen Theologie, sondern der islamischen Religionspädagogik an der Universität Münster. Wenn jemand mit diesen Abschlüssen und solch einer bescheidenen theologischen Ausbildung, so weitreichende Thesen in der Gründungsphase der islamischen Theologie in Deutschland aufzustellen vermag, stellt sich bei mir die Frage: Wie kommt das? Woher dieser Übermut und diese Selbstüberhebung? Wo bleibt die von ihm in seinem Werk viel gepredigte menschliche Bescheidenheit und die wissenschaftliche Mäßigung?
Einzig der Fußnotenapparat in seinem Buch ist mehr als bescheiden. Von einem Beamten, der auch mit den Steuergeldern der Muslime finanziert wird, hätte ich mehr Takt und vor allem noch mehr wissenschaftliche Tiefgründigkeit für eine solche revolutionäre, humanistische und aufgeklärte Theologie – so jedenfalls die unbescheidene Selbstzuschreibung Khorchides – erwartet.
Jeder kann glauben, was er möchte. In diesem Land besteht Gott sei Dank im Gegensatz zu manch einem islamisch bezeichneten Staat die Religionsfreiheit. Jeder kann auch zu religiösen Positionen jede Meinung vertreten und wissenschaftlich zu begründen versuchen, hier gilt die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. Unislamische Glaubensüberzeugungen mit der Autorität und der Würde eines Professorentitels an einer Universität und der Unterstützung von nichtmuslimischen Vertretern der Medien als islamisch zu etikettieren und dies den Muslimen als den wahren Islam aufdrücken zu wollen, kann und werde ich jedoch nicht akzeptieren. Extremistische und gewaltverherrlichende Positionen werden wir ebenso konsequent verurteilen, wie auch bevormundende sogenannte Liberalisierungs- und Verniedlichungstendenzen des Islam durch Beamte des Staates, die den Islam tatsächlich aushöhlen und hybridisieren.
Zum Abschluss
Zum Abschluss möchte ich Prof. Khorchide mit seinen eigenen Worten aufrufen, darüber nachzudenken, inwieweit das von ihm in seinem Buch favorisierte Verständnis von Glaube, Gott, Jenseits und Religion noch islamisch ist, und inwiefern dies eine einseitige Aufgabe religiöser Überzeugungen zu Gunsten der Hingabe an den Zeitgeist darstellt.
„Es wäre ja mehr als schade, wenn man sein Leben lang einen Gott anbetet, der sich am Ende als eine Projektion herausstellt und mit Gott selbst so gut wie nichts zu tun hat. Dann hat man eigentlich alles verloren, und alles ist dann umsonst gewesen: Man hat sich das ganze Leben nur um sich selbst gedreht und mehr oder weniger seine eigene Vorstellung angebetet: „Sollen wir euch Menschen sagen, wer die größten Verlierer sind? Das sind diejenigen, deren Eifer umsonst war, während sie glaubten, das Richtige zu tun.““ (S. 145)
//1r//Avni Altiner ist der Vorsitzende der Schura Niedersachsen. Vergangenes Jahr verlieh die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover Altıner einen Ehrenpreis für sein Einsatz um Respekt, Toleranz und Verständnis zwischen den Religionen.