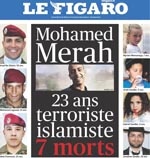(iz). In der Ausgabe des deutschen Magazins „GEO-Epoche“ über die Wikinger steht es Schwarz auf Weiß: „Bis zu 100 Millionen arabische Münzen schafften die Wikinger einst nach Norden, mehr als 80.000 sind allein in Schweden gefunden worden“. Die als raue Antichristen verschrieenen Heiden hatten auf ihren Marktplätzen offensichtlich kein Problem mit dem Symbol des Glaubens aus dem fernen Osten. Auf abenteuerlichen Wegen hatten die kleinen Boote der Wikinger die fernen islamischen Städte bis nach Bagdad erreicht. Über Jahrhunderte hatten diese Münzen aus der islamischen Welt eine völkerverbindende Funktion.
In diesen „goldenen“ Zeiten war der islamische Dinar ein sicheres Mittel gegen Inflation. Die Kaufkraft von Gold blieb im Orient für beinahe 2.500 Jahre ohne größere Veränderungen und dient als Bezugspunkt für alle Silberwährungen, die in ihrem Wert immer wieder Schwankungen unterworfen waren. „Unter Darius dem Großen (522-486)“, berichtet der Münzkundler Walther Hinz in seinen Untersuchungen zu islamischen Währungen, „kostete ein Hammel im Durchschnitt 5,40 Goldmark; der selbe Preis ist – um nur ein einziges Beispiel herauszukriegen – in Anatolien im Jahr 1340 bezeugt“.
Sucht man heute mit Google nach dem Islamischen Dinar, finden sich über zwei Millionen Einträge. Tausende Internetseiten diskutieren Nutzung, Vertrieb und Einsatz der traditionellen islamischen Währung.
Die berühmte 4,25 Gramm schwere Münze aus Gold schien mit dem globalen Siegeszug der Fiat-Währungen aus dem islamischen Bewusstsein gedrängt. Der Niedergang der islamischen Welt zeigte sich auch im Bedeutungsverlust ihrer Währungen. In seiner „Osmanischen Geschichte“ beschreibt Halil Inalcik nicht nur den Fall der osmanischen Dynastie, sondern auch die gleichzeitige Aufgabe der Gold- und Silberwährungen zu Gunsten der zunehmenden Einführung von Papiergeld ab dem Jahre 1840.
Gold- und silbergedeckte Währungen hatten in Europa zunehmend, den Ruf altmodisch zu sein und die Zeichen der Zeit zu verkennen. Der weltweite Siegeszug der europäischen Banken war ohne die gleichzeitige Einführung von strategischer Verschuldung und Papiergeld nicht denkbar. In Zeiten absehbarer Inflation und verbreiteter Ungerechtigkeit durch Währungsspekulationen ändert sich heute wieder die Einstellung zum Papier.
Seit der Schulden- und Bankenkrise erinnern sich auch Muslime vermehrt an den Sinn ihrer alten Maßeinheiten. Die Erinnerung tut not, denn der Dinar hat als Einheit nicht nur mit profanen ökonomischen Interessen zu tun, sondern ist auch mit der korrekten Zahlung der Zakat verknüpft. Die Standardisierung des Gewichts und die Feinheiten der Wechselkurse der Einheiten waren, im muslimischen Alltag, praktisch immer mit der Notwendigkeit einer korrekten Zahlung der Zakat verknüpft. Bereits zur Zeit des Kalifen ‘Umar ibn Al-Khattabs wurde ein festes Standardgewicht der zu dieser Zeit benutzten Münzen ermittelt, gerade eben auch um die Zakat besser berechnen zu können.
Der Herrscher ‘Abdulmalik hatte später in einer – für die Muslimen wichtigen Währungsreform – die Münzprägung in muslimische Hände genommen und eine eigene Münzprägeanstalt etabliert. Philip Grierson beschreibt in seiner Abhandlung „die Geldreform Abdulmalik’s“ die Bemühungen um einheitliches Aussehen und Standards der Münzen. Die Münzhoheit wurde nun auch im Islam ein wichtiges Zeichen der politischen Souveränität. Ibn Khaldun widmet in seiner berühmten „Muqqadima“ der Prägung von Münzen ein eigenes Kapitel. Dort erinnert er an die verbindliche Verpflichtung politischer Führung: „Er muss sich um die Münzprägung kümmern, um die Währung zu vor Betrug schützen, die von den Leuten in ihren gegenseitigen Transaktionen benutzt wird.“ Heute wird die neue Dinarwelt von hunderten, voneinander unabhängigen Akteuren mit neuem Leben erfüllt. Grundsätzlich kann jede islamische Autorität an jedem Ort der Welt – mit völlig unterschiedlichem Design – einen neuen Dinar in Umlauf bringen. Die führenden Hersteller haben sich allerdings neben dem Gewicht und der Größe auch auf bestimmte Standards bei der Herstellung geeignet. Die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts erlauben die Herstellung von Münzen von höchster Qualität und besonderer Reinheit.
In einer Welt mit globalen Handelsströmen ist die Qualität und Authentizität der Münzen wichtig. Der Umlauf von Falschmünzen ist ein altes Problem. Heute sind allerdings neue Sicherheitsmerkmale auf den Münzen möglich, die man früher nicht kannte. Auf die Goldmünzen können in einem aufwändigen Verfahren beispielsweise Hologramme gespritzt werden, die die im Umlauf befindlichen Münzen fälschungssicher machen sollen. Andere Anbieter experimentieren bereits mit unsichtbaren Sicherheitsmerkmalen, die aber mit einfachen Geräten von den Nutzern erkannt werden können.
Moderne Zahlungssysteme im Internet machen deutlich, dass das Bekenntnis zum Dinar keine rückwärtsgewandte Romantik ist. Dinare sollen nicht etwa für das Museum geschaffen werden, sondern können heute wieder in Wadias gesammelt, über Wakalas vertrieben und mit modernen Zahlungssystemen in alle Welt gesendet werden. Dinare – so gesehen die Basis eines ausgeklügelten Wirtschaftssystemes und eine potenzielle „Weltwährung“ – können auch die wertbeständige Grundlage von Investmentvereinbarungen im Rahmen islamischer Verträge sein. Wichtig ist die zu jedem Zeitpunkt zu gewährleistende physische Existenz der Währung. Der Handel mit auf Papier gedruckten Zahlungsversprechen ist im islamischen Recht ausdrücklich nicht erlaubt. Das Zusammenspiel der diversen ökonomischen Einrichtungen machen im Islam auch ein Wirtschaftsmodell ohne klassische Banken denkbar. Auch im Westen wird diese wirklich alternative Seite des Islam zunehmend entdeckt.
Ob und wie man den Dinar nutzt, ist kein Politikum, es ist kein Indiz, ob man eine liberale oder konservative Weltanschauung hat, sondern der Dinar ist nur die einfache Grundlage und Recheneinheit des islamischen Wirtschaftsrechts. Auf dem Markplatz kann der Dinar – wie seit jeher – das Zahlungsmittel von Kaufleuten, Konsumenten und Händlern – natürlich auch von muslimischen Frauen, Juden und Christen – sein. Der islamische Markt erlaubt die freie Wahl der Zahlungsmittel. Die Nutzer vertrauen dem Dinar allein wegen seinem Gewicht und dem jeder Münze inne wohnenden Wert.
Der Dinar als Maßeinheit beschäftigt auch wieder eine Philosophie, die in der Einführung des Papiergeldes – wie das zum Beispiel Goethe voraussah – einen Schlüssel für den entfesselten Kapitalismus und damit die Gefährdung der Schöpfung sah. Die Begrenzung der Macht der Technik und insbesondere der Finanztechnik ist tatsächlich eine wichtige Dimension des islamischen Wirtschaftsrechts. Dabei gerecht und im Konsens mit Jedermann zu handeln, ist eines der wichtigsten qur’anischen Gebote.
Es gibt inzwischen aber auch andere Motivationen, gold- und silbergedeckte Währungen einzuführen. Mittlerweile existiert so etwas wie eine weltweite Bewegung der Gold-Befürworter. Alleine in den USA wollen 13 Bundesstaaten echte Münzen wieder als „Legal Tender (legales Zahlungsmittel)“ einführen. In Europa sind dem Vertrieb von Dinaren oder anderen goldgedeckten, privaten Zahlungsmitteln praktische Grenzen gesetzt. Zwar kann man auch in Deutschland, wie ein Blick in das Münzgesetz und die Medaillenverordnung zeigt, so genannte Medaillen produzieren. Sie sind aber mit Mehrwertsteuer zu verkaufen und damit gegenüber staatlichen Münzen (Legal Tender) nicht wettbewerbsfähig.
Inzwischen gibt es auch in Deutschland gewichtige Stimmen, sogar im deutschen Bundestag, die die freie Wahl von Zahlungsmitteln ohne Benachteiligung gegenüber staatlichem Geld befürworten. Nach der liberalen Überzeugung des FDP-MdB Schäffler kann nur durch einen fairen Wettbewerb der Zahlungsmittel verhindert werden, dass Staaten Unmengen schlechten Geldes in Umlauf setzen. Diese Position die auch die Marktgesetze für Geld gelten lassen will findet immer mehr Anhänger.