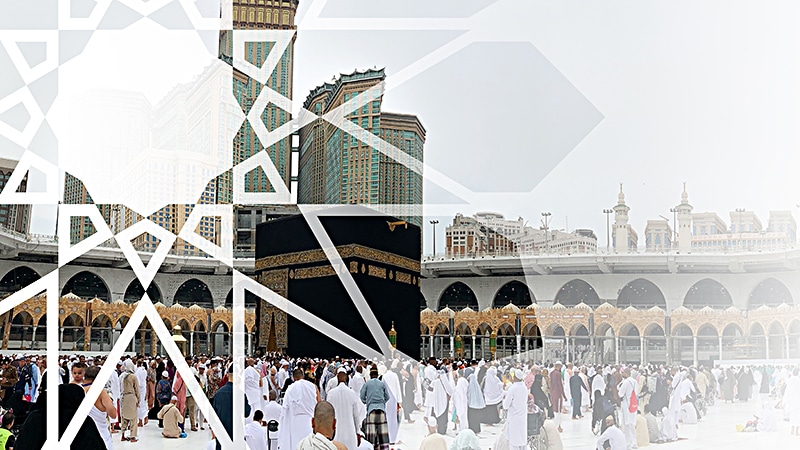IZ-Begegnung mit Schaikh Muhannad Yusuf über die wesentlichen Elemente des islamischen Wissens, notwendige Schritte in seinem Erwerb, warum dazu eine Reinigung von Charakters sowie Herzen gehört und welche Eigenschaften Gelehrte in der heutigen Zeit brauchen.
(iz). Schaikh Muhannad Yusuf erlernte und studiert seit seiner Kindheit die wesentlichen Wissenschaften des Islam. Seine Studien fanden unter Anleitung renommierter mauretanischer Schuyukh und ‘Ulama statt.
Zu seinen vielfältigen Aufgaben im In- und im Ausland gehört die Leitung der Madrassa der Nour Community in Deutschland. „Das Ziel seiner Lehrtätigkeit besteht darin, die klassischen islamischen Wissenschaften fundiert und praxisnah zu vermitteln“, findet sich auf der Webseite zu seiner Person. Darüber hinaus schloss er in seiner Jugend Schulungen für Management und TV-Journalismus ab.
Von 2017 bis 2020 war er Imam einer Moschee in Minden und übernahm sowohl die Rolle des zweiten als auch teilweise des ersten. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die Freitagsansprachen und alle traditionellen Pflichten dieses Amtes.
Er gründete den größten islamischen Discord-Server Deutschlands und erreichte weltweit Platz zwei. Dieser zählt heute über 6.700 Mitglieder und wurde initiiert, um Jugendliche auf ihrem digitalen Weg abzuholen und ihnen eine Plattform für Austausch und Bildung im Din zu bieten.
Die Schüler sind aktiv für die wissenschaftliche Arbeit in der Akademie zuständig, wodurch sie nicht nur ihr Wissen vertiefen, sondern auch Verantwortung übernehmen können. Es handelt sich um ein sehr erfolgreiches Projekt, das bis heute wächst.
In einem umfangreichen Hintergrundgespräch befragten wir ihn u.a. zu den Grundelementen des Wissens, was zu einer substanziellen Ausbildung gehört, warum die Nachfolge einer Rechtsschule so wichtig ist und wieso insbesondere unsere Gelehrten frei sein müssen, um ihre Aufgabe authentisch erfüllen zu können.
Islamische Zeitung: Lieber Schaikh Muhannad, Sie selbst sind engagiert in der Vermittlung von islamischen Wissenschaften. Welche Fragen und Themen sind für die hiesigen Muslime – insbesondere die Jugend – gerade am drängendsten bzw. relevantesten?
Schaikh Muhannad: Das drängendste Thema für die muslimische Jugend in Deutschland ist die Frage nach Orientierung. Diese entsteht nicht durch einzelne Schlagworte, sondern durch ein solides Fundament.
Damit meine ich das islamische Grundwissen, das in unserer Tradition als Fard ‘Ayn bezeichnet wird – also das Pflichtwissen, das jeder Muslim beherrschen muss. Dieses umfasst den Kern in ʿAqida, im Fiqh und im Tasawwuf – also Glaube, Handeln und Spiritualität. Wer dieses Fundament hat, besitzt eine gesunde Basis.
Zu diesem Grundwissen gehören heute aber auch die islamischen Antworten auf die Probleme der Zeit. Nur wenn beides zusammenkommt – klassisches Pflichtwissen und ein Verständnis der Gegenwart – entsteht eine realistische, gesunde und zukunftsorientierte muslimische Persönlichkeit.
Ohne dieses Fundament hingegen entsteht oft eine verwirrte, orientierungslose Haltung, die entweder zur Last für Familie und Umfeld wird oder sogar in extremistische Strömungen abgleitet.
Hier zeigt sich, wie zentral Bildung ist. Bildung, Bildung, Bildung – und Aufklärung – das sind die Schlüssel, um Jugendliche zu stabilisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, positiv zu wirken. Die Botschaft des Islam ist genau so aufgebaut: Das Grundwissen ist elementar und führt zu einer ausgewogenen Persönlichkeit. Vertiefende Wissenschaften sind ebenfalls wichtig, sollten aber denjenigen offenstehen, die sich aus eigenem Antrieb weiter spezialisieren wollen.
Darüber hinaus reicht es nicht aus, „nur“ in Deutschland zu leben. Man muss auch verstehen, wie dieses Land historisch, kulturell und politisch zu dem geworden ist, was es heute ist. Ohne dieses Wissen kann man sich nicht gesund einbetten. Ein Mindestmaß an Kenntnissen über Geschichte, Philosophie und die gesellschaftliche Ordnung ist daher unverzichtbar.
„Die Jugend darf sich nicht von Negativschlagzeilen lähmen lassen. Wer Pflichtwissen erwirbt, Chancen ergreift und seine Rolle erkennt, wird die Zukunft dieses Landes aktiv mitgestalten.“
Ein weiterer Aspekt ist der demografische Wandel, der Deutschland große Herausforderungen, aber auch enorme Chancen bringt. Dieses Land wird in den nächsten Jahren viele Arbeitskräfte brauchen.
Wenn die muslimische Jugend ihre Zukunft aktiv mitgestalten will, muss sie sich ernsthaft mit Bildung, Berufsfeldern und gesellschaftlichem Engagement befassen. Denn wer die vorhandenen Chancen nicht nutzt, wird übersehen – und andere werden über die Köpfe hinweg entscheiden.
Hier liegt eine große Möglichkeit: Muslime können diese Lücken füllen, Verantwortung übernehmen und einen positiven Beitrag leisten – im karitativen Bereich, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Verwaltung. Das ist nicht nur eine Frage der Integration, sondern auch der Gestaltung.
Jugendliche sollten deshalb nicht in erster Linie auf die gegenwärtige Stimmung des Rechtspopulismus schauen und sich entmutigen lassen. Solche Strömungen sind zeitlich begrenzt und politisch wechselhaft. Was aber bleibt, sind die Fakten: der demografische Wandel, die Notwendigkeit von Arbeitskräften und die Realität, dass alle gebraucht werden. Früher oder später wird das auch zu einem Wandel im gesellschaftlichen Klima führen.
Wenn dieses Fundament gelegt ist – islamisches Grundwissen, Bewusstsein für die eigene Rolle und Blick auf die realen Chancen – dann stellen sich die wirklich relevanten Fragen: Welches Pflichtbewusstsein habe ich gegenüber Allah, meiner Familie und der Gesellschaft, in der ich lebe? Und wie kann ich meinen Auftrag als Khalifa erfüllen und nützlich sein?
Islamische Zeitung: Unsere Wissenschaften – von der Qur’anwissenschaft bis zum Tasawwuf – folgen ja inneren Denklogiken und ihren jeweils eigenen Methodologien. Muss man als Lehrer vor der Vermittlung vom konkreten Wissen seinen Schülern erst beibringen, welche Kenntnisse für sie geeignet sind und nicht?
Schaikh Muhannad: Ja – unbedingt. Bevor Wissen vermittelt wird, muss man dem Schüler beibringen, wie man Wissen trägt und welche Stufen für ihn geeignet sind. Nicht jedes Wissen ist für jeden in jedem Moment gut. Die islamischen Wissenschaften lassen sich – vereinfacht gesagt – in drei Ebenen gliedern:
Zielsetzung: Jede Wissenschaft hat nicht nur den Zweck, die göttliche Wahrheit von Qur’an und Sunna und die Praxis der ersten Generationen zu bewahren. Ebenso wichtig ist, dass wir ihre Methoden bewahren – also wie sie die Probleme ihrer Zeit verstanden, analysiert und gelöst haben.
Nur so können wir heute auf gleiche Weise die Fragen unserer Zeit angehen. Es geht also nicht darum, bloß alte Antworten zu wiederholen, sondern auch ihre Art des Forschens lebendig zu halten.
Methodik: Jede Disziplin besitzt ihre Werkzeuge. Dazu gehören die Usul und Qawa‘id, die sich durch Jahrhunderte intensiver Diskussionen herausgebildet haben. Aber auch hier geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern darum, wie diese Ergebnisse entstanden sind – welche Fragen gestellt wurden, welche Analysen vorgenommen wurden und wie man schließlich zu Lösungen gelangte. Diese Methodik gibt uns den Schlüssel, heutige Fragen mit derselben Tiefe und Präzision zu behandeln, wie es die Gelehrten mit den Problemen ihrer Zeit getan haben.
Praxis: Schließlich geht es um die Anwendung – sowohl das Beherrschen und Verstehen des bereits vorhandenen Wissens als auch das Erarbeiten neuer Antworten für die Herausforderungen der Gegenwart. Jede Zeit bringt neue Fragen hervor, und die Praxis islamischer Wissenschaft besteht darin, sie auf der Grundlage von Qur’an, Sunna, Usul und Tradition zu beantworten.
Diese Dreiteilung ist eine Vereinfachung, um die Struktur verständlich zu machen. In Wirklichkeit sind die Disziplinen noch vielschichtiger, doch alle greifen ineinander. Ein Gelehrter verbindet Qur’anwissenschaft, Fiqh, Tasawwuf und Methodologie, wenn er eine Fatwa gibt oder einen Rat ausspricht.
„Ein Lehrer vermittelt nicht nur Inhalte – er gibt Reihenfolge, Eignung und Erziehung vor. Nur so wird Wissen zum Licht und nicht zur Last.“
Das Problem unserer Zeit ist jedoch, dass diese Reihenfolge oft nicht eingehalten wird. Viele Jugendliche beschäftigen sich mit Hadith-Bewertungen, Überliefererkritik oder alten Streitfragen, die längst abgeschlossen sind – ohne die Grundlagen zu beherrschen.
Andere steigen sofort in Themen wie Takfir (das Ausschließen von Muslimen) ein, obwohl ihnen sowohl Wissen als auch Erziehung fehlen. Dadurch entsteht Verwirrung, Spaltung und im schlimmsten Fall Radikalisierung.
Noch gravierender ist, dass sich heute beinahe jeder im Internet zum Islam äußert – unabhängig von Bildung, Charakter und Eignung. Dabei geht verloren, dass islamisches Wissen auf kollektiven Ergebnissen beruht: den jahrhundertelangen Diskussionen und Konsensen der Gelehrten. Wer nicht in dieser Tradition verankert ist, verliert Respekt vor diesem Erbe und konstruiert eigene Wege.
Deshalb braucht es neben Wissen immer auch Erziehung (tarbiya), die den Charakter festigt und den Schüler befähigt, Wissen verantwortungsvoll zu tragen. Scharfe Werkzeuge dürfen nicht in unreifen Händen liegen.
Genau aus diesen Beobachtungen und Beratungen mit Gelehrten heraus ist die Nour Islam Akademie entstanden. Sie arbeitet präventiv, indem sie bei den Wurzeln ansetzt – nicht bei Symptomen. Wir vermitteln das islamische Grundwissen in der richtigen Reihenfolge und begleiten es mit spiritueller Erziehung.
Gleichzeitig halten wir an den Fundamenten der Tradition fest, entwickeln aber Lösungen für die heutigen Herausforderungen. Ziel ist es, eine Generation auszubilden, die die Werkzeuge der Gelehrten versteht, sie verantwortungsvoll nutzt und später selbst dieses Wissen an andere weitergibt.
„Alle Rollen im islamischen Wissen teilen ein Fundament. Unterschiede entstehen durch Spezialisierung, Verantwortung und die historische Entwicklung der Begriffe.“
Islamische Zeitung: Wenn es um das Wissen und seine Träger geht, fallen häufiger mal Begriffe wie Imam, ‘Alim, Faqih, Mufti oder Schaikh. Können Sie uns diese Aufgaben erläutern und worin deren Unterschiede bestehen?
Schaikh Muhannad: Im Islam ist Wissen zu einer Wissenschaft geworden, damit spätere Generationen immer wieder auf dieselben Quellen zurückgreifen und Antworten finden können. Wie in allen Wissenschaften gibt es auch hier ein Fundament, das alle teilen, und Spezialisierungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet haben. Die wichtigsten Begriffe lassen sich unterscheiden.
Imam: Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff große Vorbildgelehrte – Persönlichkeiten wie Imam Malik oder Imam al-Nawawi, die in nahezu allen islamischen Disziplinen herausragende Beiträge geleistet haben. Sie verbanden die Fachbereiche, schufen Grundlagen, auf die alle späteren Gelehrten aufbauten, und hinterließen Werke, die bis heute angewendet werden. Im späteren Sprachgebrauch hat sich der Begriff jedoch erweitert und bezeichnet heute meist den Vorbeter in der Moschee. In wissenschaftlichen Kontexten aber wird der Begriff Imam weiterhin in seiner ursprünglichen, hohen Bedeutung verwendet.
‘Alim: Wörtlich „der Wissende“. Damit ist ein Gelehrter gemeint, der über ein breites Fundament verfügt und oft auch wissenschaftlich forscht und publiziert.
Faqih: Ein Spezialist für Fiqh, also das islamische Recht. Nicht jeder Faqīh ist ein Muftī – aber jeder Mufti muss ein Faqij sein.
Mufti: Derjenige, der nicht nur Fiqh beherrscht, sondern auch befähigt ist, Fatwas – also Rechtsgutachten – zu aktuellen Fragen zu geben. Ein Mufti arbeitet oft interdisziplinär, zieht Experten hinzu (etwa bei medizinischen oder technischen Fragen) und verbindet deren Wissen mit den Grundlagen des islamischen Rechts.
Schaikh: ein Oberbegriff für Lehrer und Meister. In der arabischen Welt ist es die Sammelbezeichnung für Gelehrte.

Allen diesen Rollen ist ein gemeinsames Fundament eigen: die Grundausbildung im islamischen Pflichtwissen, die überhaupt erst befähigt, über den Islam zu sprechen. Danach folgen Spezialisierungen, die mit unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen verbunden sind.
Natürlich ist diese Darstellung sehr vereinfacht. In einem wissenschaftlichen Rahmen ließe sich das noch viel detaillierter und fundierter erklären. Für den allgemeinen Überblick und die breite Leserschaft genügt diese Einteilung jedoch.
„Die Rückkehr zu den Rechtsschulen ist eine Chance für Klarheit und Stabilität – vorausgesetzt, sie wird nicht durch willkürliche Zitate oder politische Interessen missbraucht, sondern im Geist der Tradition und Methodik vermittelt. Die malikitische Schule ist dabei ein besonders starkes Beispiel, ohne die Bedeutung der anderen Rechtsschulen zu mindern.“
Islamische Zeitung: Jahrzehntelang haben ideologische Bewegungen starken Einfluss auf das geistige Klima von Muslimen nicht nur hier genommen. Seit mehreren Jahren schon wenden sich Junge und Interessierte von diesen ab und den Rechtsschulen zu. Auch, weil sie sich von diesen eine Rückbindung zum Vorbild Madina erwarten. Wie sehen Sie diesen Aspekt in Deutschland?
Schaikh Muhannad: Ideologische Bewegungen haben meist keine lange Lebensdauer. Sie gewinnen oft in den jungen Jahren der Menschen an Einfluss – in der Pubertät, in der Suche nach Identität – und verlieren später an Kraft, wenn Menschen älter werden und mehr Lebenserfahrung sammeln.
Heute sehen wir, dass viele junge Muslime erkennen, dass diese Bewegungen keine tragfähigen Antworten bieten. Durch das Internet haben sie Zugang zu vielen Stimmen, können vergleichen und erleben, dass die Argumente der klassischen Tradition und der Rechtsschulen stärker und nachhaltiger sind. Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Allerdings muss man wachsam sein: Es gibt politische Gruppen, die für ihre eigenen Ziele die Religion missbrauchen. Sie arbeiten ähnlich wie Parteien – sie sagen, was die Menschen gerne hören möchten, um sie zu binden.
Manche von ihnen geben sich heute den Anschein, „rechtsschulgebunden“ zu sein. Sie behaupten etwa, sie würden der hanbalitischen Schule oder sogar mehreren Rechtsschulen zugleich folgen. In Wirklichkeit vertreten sie jedoch nicht die Inhalte, die Methodik oder den Geist dieser Schulen. Es bleibt bei Etiketten, ohne Substanz.
Man erkennt diese Gruppen daran, dass sie Aussagen und Zitate einzelner Gelehrter willkürlich herausnehmen, ohne den gesamten Rahmen, die Methodik und die innere Logik der jeweiligen Rechtsschule zu respektieren. So entsteht ein Bild, das oberflächlich nach Rechtsschule aussieht, inhaltlich aber entweder wahhabitische oder salafistische Lehren transportiert – oder politische Programme.
Ein einfacher Muslim, der gerade erst die Rechtsschulen kennenlernt, kann das kaum durchschauen. Er denkt, er habe den Weg zum traditionellen Islam gefunden – nur um nach Jahren festzustellen, dass er in Wirklichkeit in einer politischen oder sektiererischen Struktur gelandet ist.
Gerade hier zeigt sich die besondere Stärke der malikitischen Schule, die seit jeher eng mit Medina und der Tradition des Propheten verbunden ist. Der große Gelehrte al-Hafiz as-Subki sagte über sie: „Und Allah hat die Malikiten rein bewahrt: Wir haben keinen Malikiten gesehen, außer dass er in seiner Glaubenslehre asch‘aritisch war.“
Dieses Zeugnis passt deshalb besonders gut, wenn es um die medinensische Schule geht. Gleichzeitig gilt: Auch die anderen Rechtsschulen können – wenn ihre Vertreter sich konsequent um die Wahrung der Tradition bemühen – davor bewahrt bleiben, von politischen oder ideologischen Strömungen vereinnahmt zu werden.
Wirklich fruchtbar wird die Rückkehr zu den Rechtsschulen nur dann, wenn sie rein religiös vermittelt werden – ohne politische Hintergründe, ohne ideologische Instrumentalisierung. In diesem Fall eröffnet sich ein großes Potenzial, auch hier in Deutschland.
„Online ist eine Tür zum Wissen – aber niemals der Raum selbst. Wirkliche Lehre braucht Nähe, Erziehung und den direkten Blick zum Lehrer.“
Islamische Zeitung: Lieber Schaikh Muhannad, Sie gehören zu denjenigen Gelehrten hier, die aktiv und erfolgreich verschiedene Online-Medien und Plattformen zur Wissensvermittlung nutzen. Hat der Einsatz solcher Mittel einen Einfluss auf die Form der Lehre?
Schaikh Muhannad: Natürlich hat der Einsatz von Online-Medien einen Einfluss auf die Lehre – und zwar einen sehr deutlichen.
Aus meiner Erfahrung ist Online-Unterricht in erster Linie Wissensvermittlung. Was dabei fast völlig fehlt, ist die Erziehung (tarbiya). Zwar habe ich erlebt, dass einzelne Menschen selbst über Online-Kanäle tief geprägt wurden – aber das sind seltene Ausnahmen.
Der klassische Unterricht vor Ort umfasst viel mehr: Erziehung, Begleitung, Adab, die geistige und seelische Verbindung zwischen Lehrer und Schüler. Im Hadith von Jibril sehen wir, dass die Überlieferung des Wissens direkt von Angesicht zu Angesicht geschieht. Online kann diesen Kanal nicht ersetzen.
Deshalb habe ich auch die Nour Islam Akademie von Anfang an als hybrides Modell aufgebaut: Online-Angebote ermöglichen Zugang und Flexibilität – etwa für Menschen, die reisen oder weit entfernt wohnen. Aber das Herzstück ist und bleibt der Unterricht vor Ort. Denn aus meiner eigenen Erfahrung ist das Lernen in direkter Nähe zum Lehrer wesentlich effektiver, tiefgründiger und nachhaltiger.
Online birgt zudem viele Gefahren: Ablenkung, fehlende persönliche Nähe und vor allem keine echte geistige Bindung. Eine gute Information, die in einem falschen Kanal aufgenommen wird, kann sogar Schaden anrichten. Deshalb kann Online-Unterricht niemals den direkten Kontakt ersetzen.
Wer es ernst meint mit islamischer Lehre, sollte online nur als ergänzendes Werkzeug nutzen. Für jene aber, die nur auf Selbstinszenierung und Reichweite aus sind, ist das Internet die perfekte Bühne – doch was bleibt, ist verbrannte Erde.

„Online-Wissen ist wertvoll – aber immer mit Vorsicht zu genießen.“
Islamische Zeitung: In der englischsprachigen Welt sind viele, international bekanntere ʿUlamā im Internet unterwegs. Hätten Sie Tipps & Ratschläge für den erfolgreichen und gleichzeitig sicheren Umgang mit dem Netz in Deutschland?
Schaikh Muhannad: Der englischsprachige Raum ist zahlenmäßig sehr viel größer, deshalb sind dort viele Gelehrte online sichtbarer. Im deutschsprachigen Raum ist die Zahl kleiner, aber das Interesse ist hier besonders konzentriert.
Das Internet kann ein wertvolles Werkzeug sein – aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Inhalte sollten nicht Trends hinterherlaufen, sondern Maßstäbe setzen. Und man sollte sich bewusst sein: Im deutschsprachigen Raum gibt es weniger Gelehrte, deshalb können falsche Stimmen schneller Einfluss gewinnen.
„Solange die Wurzeln krank sind, bleibt jede Debatte ein Streit über Symptome. Erst wenn das Fundament gesund ist, können wir die wirklich relevanten Fragen angehen.“
Islamische Zeitung: Welche Fragen wären für Sie augenblicklich von vorrangiger Relevanz für die Muslime in diesem Land? Diskutieren wir über die falschen Dinge?
Schaikh Muhannad: Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Die Anliegen von Muslimen in einem Dorf unterscheiden sich oft von denen in einer Großstadt. Dennoch gibt es gemeinsame Belange, die uns alle betreffen.
Ich glaube, dass viele der heutigen Diskussionen nur Symptome sind – nicht die eigentliche Krankheit. Man kann endlos über Detailfragen streiten, aber ohne Fundament führen solche Debatten zu nichts. Die Wurzeln sind das Entscheidende: islamisches Pflichtwissen, richtige Führung und klare Maßstäbe.
Wenn diese Basis fehlt, ist keine Einigung möglich. Jeder hält sein eigenes Thema für das wichtigste, und am Ende wird mehr gestritten, als dass Lösungen entstehen. Viele, die heute als „Stimmen des Islam“ auftreten, sind in Realität nur Vertreter bestimmter Gruppen oder Parteien. Das verschärft die Verwirrung zusätzlich.
Die tatsächlich relevanten Fragen sind daher nicht die Schlagzeilen von heute, sondern: Wie stärken wir das Fundament der Muslime? Wie sichern wir Pflichtwissen, Erziehung und Verortung in dieser Gesellschaft? Wenn diese Basis gelegt ist, lösen sich viele Nebendebatten von selbst.
„Wir brauchen Räume für echten Austausch – geschützt, neutral und inhaltsorientiert. Nur so können Gelehrte und Gemeinschaft einander erreichen.“
Islamische Zeitung: Muslime unterschiedlicher Herkunft oder Alters sowie ihre Gemeinschaften suchen einerseits bei drängenden, manchmal kontroversen Fragen tragfähige Antworten von der Lehre. Andererseits haben sich die meisten in der Bundesrepublik bekannten Gelehrten in den letzten 10–15 Jahren – aus Gründen – dazu entschieden, den öffentlichen Dialog oder die Debatte (nach negativen Erfahrungen) zu meiden. Brauchen wir in Deutschland mehr Gelegenheiten, auf denen sich die Leute des Wissens einerseits untereinander austauschen, und andererseits zugänglicher sind für den Dialog mit der muslimischen Community im Ganzen?
Schaikh Muhannad: Ja, wir brauchen solche Möglichkeiten dringend. Ein geschützter Rahmen, in dem Gelehrte miteinander und mit der Gemeinschaft diskutieren, ist viel wertvoller als die oft oberflächlichen Debatten in den sozialen Medien. Dort geht es zu schnell um Schlagzeilen und persönliche Egos, statt um Inhalte.
Solche Formate müssten gut moderiert und neutral begleitet werden – vielleicht könnte das auch eine Aufgabe für eine Zeitung wie die Ihre sein. Denn Gelehrte brauchen Räume, in denen sie sich austauschen können, und die Gemeinschaft braucht den direkten Zugang zu ihnen.
Gleichzeitig darf man nicht nur darauf warten, dass solche Formate entstehen. Jeder von uns trägt Verantwortung, Debatten lebendig zu halten – und zwar mit dem Grundsatz: Es geht nicht um Personen, nicht um Interessen, sondern um Inhalte.
Natürlich gibt es die Schwierigkeit, dass manche Gruppen sich selbst als „die Mitte“ darstellen, obwohl sie in Wahrheit eine parteiische Richtung vertreten. Genau deshalb ist es so schwer, wirklich neutrale Räume zu schaffen. Aber das sollte uns nicht abhalten, daran zu arbeiten.
Islamische Zeitung: Lieber Schaikh Muhannad, wir bedanken uns recht herzlich für das substanzielle Gespräch.