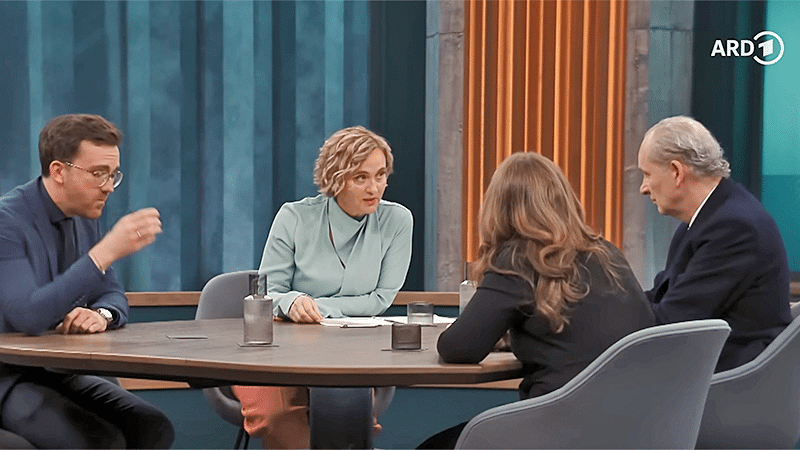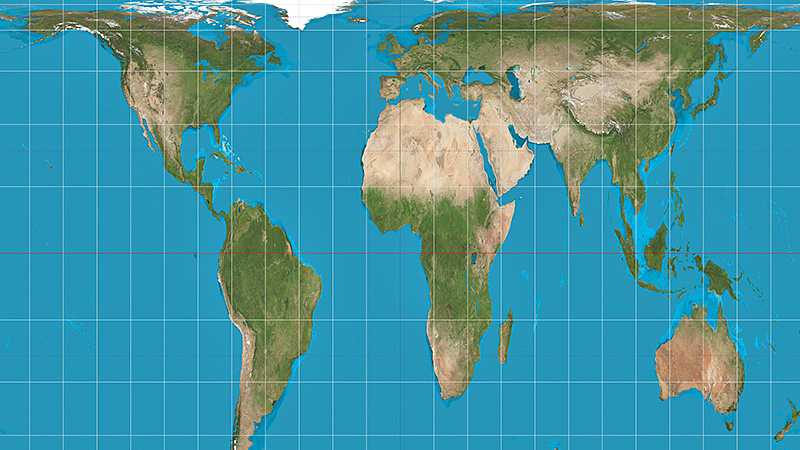Die Debatte über das Stadtbild übersieht wichtige Fragen zum öffentlichen Raum und der Bildersprache. Eine Chance für Muslime zur Positionierung.
(iz). Bildersprache statt Sachpolitik: Der Beitrag von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Migrationspolitik, die das „Stadtbild“, also die urbane Erscheinung und Atmosphäre in deutschen Städten, beeinflussen soll, löste eine heftige Debatte aus.
Er betonte, dass seine Regierung die Asylzahlen von August 2024 bis August 2025 um 60 % gesenkt habe, aber „im Stadtbild noch dieses Problem“ bestehe. Er bezog sich damit in erster Linie auf die sichtbare Präsenz von Migranten ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus, die er mit Sicherheitsproblemen, Kriminalität und einer Beeinträchtigung des urbanen Raums in Verbindung brachte. Auf Nachfrage präzisierte er später: Migration sei wirtschaftlich notwendig (etwa für den Arbeitsmarkt), es gebe jedoch „Probleme“ durch Personen ohne gültigen Status.
Stadtbild oder Klagen über die oberflächliche Betrachtung
In den sozialen Medien beklagen dennoch Tausende Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund die fatalen Nebenwirkungen dieser oberflächlichen Bemerkung des Kanzlers. Sie kritisieren, dass nicht das Verhalten, sondern das Aussehen die alltägliche Beurteilung von Menschen in der Öffentlichkeit bestimme.
Diese „Bildsprache“ verlagere politische und strukturelle Fragen – etwa Armut, Bildung oder Integration – in den Bereich des Sichtbaren. Kritiker betonen, dass er damit Politik auf Wahrnehmung reduziere: Migration werde zu einem visuellen Ordnungsproblem, nicht zu einem komplexen sozialen Prozess.
Noch gibt es eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die versteht, dass Kriminalität oder asoziales Verhalten kein integraler Bestandteil irgendeiner Kultur oder Religion sind. Die Probleme der Massenmigration lassen sich nur gemeinsam lösen – nicht gegen die Minderheiten, sondern mit ihnen.
Positiv gewendet, verknüpft die Debatte zwei entscheidende Aspekte künftiger Gesellschaftspolitik: Wer sind wir, und wo sind wir? Welche Identitäten entstehen im urbanen Raum des 21. Jahrhunderts? Wohin sollen sich unsere Städte entwickeln?
Darüber lohnt es sich, jenseits der Macht der Bilder, tiefer nachzudenken. Auch für Muslime ist es eine Herausforderung, eine positive Vision des Stadtlebens zu definieren.
Die Macht der Bilder oder die Macht des Raums?
Ganz unabhängig von der Rolle der Migration in unserer Gesellschaft muss man feststellen, dass sich unsere Städte in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Der grenzenlose Kapitalismus hat den Raum entdeckt – und ihn besetzt. Wohnraum ist zur Ware geworden, Nachbarschaft zum Standortfaktor, und die Verödung der Innenstädte ist Realität.
Henri Lefebvre (1901–1991), französischer Philosoph und Soziologe, hat sich intensiv mit dem Verhältnis von Raum, Gesellschaft und Macht beschäftigt. Seine Raumtheorie („Théorie de l’espace“) entwickelte er vor allem in seinem Werk „La production de l’espace“ (1974; Die Produktion des Raums), das zu den einflussreichsten Ansätzen der kritischen Raumforschung, Stadtsoziologie und Geografie zählt.
Für ihn ist der Raum selbst zur Produktionskraft geworden: Nicht mehr nur Arbeit und Kapital, sondern auch der urbane Raum – sein Takt, seine Atmosphäre, seine soziale Dichte – sind Teil der ökonomischen Maschine. Wo sich Kapital verdichtet, entstehen auch Spannungen: Vertreibung, unbezahlbare Mieten, Verteilungskämpfe, das Gefühl, dass das eigene Leben in der Stadt immer weniger Platz hat.
Ein Blick in die Lebenswelt europäischer Städte zeigt den Wandel. Berlin war einst ein Labor sozialer Durchmischung; heute ist es ein Marktplatz der Spekulation. Ganze Stadtviertel verändern sich sichtbar. Die Mieten steigen schneller als die Löhne, und alte Strukturen werden verdrängt. Die Stadt der Künstler, Studierenden und Handwerkerinnen verwandelt sich in eine Stadt der Investoren.

Foto: imago | Ina Peek
Gegenorte statt „Problemviertel“
Es mag überraschen, doch gerade in den verdrängten Rändern – in Neukölln, Wedding oder Moabit – bleibt etwas erhalten: ein urbanes Leben, das sich nicht planen lässt. Hier zeigt sich, dass das, was oft als „Problemviertel“ gilt, in Wahrheit zur sozialen Basis des Funktionierens gehört.
Überall in Europa – in den Cafés von Marseille, den Hinterhöfen von Rotterdam oder auf den Märkten Wiens – entfaltet sich eine andere Urbanität: eine, die sich der ökonomischen Logik entzieht. Hier ist Stadt nicht Produkt, sondern Praxis, ein Ort, an dem gewohnt, gehandelt, gebetet und improvisiert wird. Saskia Sassen nennt diese Räume „counter-geographies“ – Orte, an denen Menschen, oft Migrantinnen und Migranten, die Globalisierung von unten neu schreiben.
Sie schaffen Verbindungen, Infrastrukturen und Ökonomien, die im Schatten der offiziellen Planung entstehen. Ohne diese informellen Strukturen würde keine europäische Stadt mehr funktionieren. Müllabfuhr, öffentlicher Transport, Pflegeheime, Gastronomie – sie alle ruhen auf migrantischer Arbeit, auf den Händen jener, die im Diskurs oft nur als „Zuwanderer“ erscheinen, im Alltag aber die Stadt am Laufen halten.
Ob es uns gefällt oder nicht: Moderne Städte im Zeitalter der Globalisierung sind kein Postkartenidyll mehr. Richard Sennett spricht von der Notwendigkeit eines „offenen Stadtplans“ – einer Architektur, die Wandel erlaubt und das Unfertige zulässt. Eine Stadt, ein Beziehungsgeflecht, das sich verändert, ohne seine Bewohner zu verlieren.
Diese notwendige Offenheit ist die Basis einer kulturellen Haltung: Moscheen, Märkte, Teestuben, Shisha-Bars und Imbisse sind keine Bedrohung der europäischen Stadt, sondern ihre zeitgenössische Fortsetzung. Sie zeigen, dass Urbanität immer schon Mischung war – von Kulturen, Sprachen, Rhythmen, Religionen und Konflikten.
Kein Recht auf Stillstand
In dieser Welt des Wandels gibt es kein Recht auf Stillstand. Die politische Romantik vieler Konservativer träumt den Traum vergangener Tage: die Stadt als Immunsystem, der Staat, der sich hinter Grenzzäune zurückzieht und den störenden Fremdkörper einfach abschiebt. Die Abwertung der anderen als „kulturlos“ stiftet keine eigene Kultur.
Notwendig ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens, der gutes Verhalten honoriert, Kultur fördert und gemeinsames Handeln gegen Straftäter und Kriminelle organisiert. Eine gerechte Stadtpolitik muss über Identitätspolitik hinausgehen. Sie darf nicht nur fragen, wie jemand aussieht und wer dazugehört, sondern wie Teilhabe räumlich ermöglicht wird.
Die Kämpfe um Mieten, um öffentlichen Raum, um Zugänge zu Bildung und Pflege sind keine ethnischen Konflikte, sondern Auseinandersetzungen um Raumverteilung im Kapitalismus. Das heißt nicht, die Probleme der Migration zu leugnen – Drogenhandel, Gewalt gegen Frauen, Segregation, Sprachbarrieren und religiöse Spannungen sind real.
Aber sie entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern im dichten Geflecht aus Wohnungsnot, Arbeitsmarkt, Planungspolitik und Spekulation. Sind sie Symptome eines Systems, das Raum immer mehr als Ware begreift und nicht als Gemeingut?
In einer offenen Stadt würde der Wochenmarkt neben der Moschee und das Seniorencafé neben dem Halal-Restaurant nicht als Zeichen einer „Parallelgesellschaft“ gelesen, sondern als Ausdruck eines erweiterten urbanen Sinns: der Fähigkeit, Unterschiede räumlich zu organisieren, ohne sie negativ zu bewerten.

Am Kottbusser Tor: Kuppel und Minarett der Mevlana-Moschee prägen seit einiger Zeit das Stadtbild. (Foto: Shutterstock)
Was sind Stadt und Raum?
Denker wie Lefebvre wandten sich gegen die Vorstellung, die Stadt sei ein neutrales, leeres Gefäß, in dem gesellschaftliche Prozesse einfach stattfinden. Der Raum ist ein soziales Produkt: Er wird durch gesellschaftliche Praktiken, Machtverhältnisse, ökonomische Strukturen und symbolische Bedeutungen hervorgebracht. Jeder Raum ist also aktiv, dynamisch und historisch bedingt – nicht passiv oder vorgegeben. Lefebvre entwickelt ein Modell, um die soziale Produktion des Raums zu beschreiben.
Es besteht aus drei Dimensionen: dem physischen, materiellen Raum des Alltags – Straßen, Gebäude, Bewegungen –, also dem Raum, wie er gelebt und erfahren wird; dem Raum der Planer, Architekten, Politiker und Wissenschaftler – also den abstrakten, geplanten und vermessenen Räumen; und dem symbolischen, imaginären, emotionalen Raum – dem Raum, wie Menschen ihn deuten, erinnern und mit Bedeutung aufladen.
Eine zentrale politische Forderung Lefebvres (bereits 1968 formuliert): Jeder Mensch soll das Recht haben, an der Gestaltung und Nutzung des urbanen Raums teilzunehmen. Dieses „Recht auf Stadt“ ist eine Forderung nach Demokratisierung, Teilhabe und kollektiver Aneignung des urbanen Lebens.
Die umstrittene Aussage von Merz repräsentiert Lefebvres „konzipierten Raum“ – den abstrakten, von Eliten (Politik, Planer, Medien) diktierten Blick auf die Stadt, der Minderheiten unsichtbar macht, sie nur als Arbeitskräfte akzeptiert oder gar als Bedrohung pathologisiert.
Das „Recht auf Stadt“ fordert stattdessen, dass Minderheiten – etwa Geflüchtete oder ethnische Gruppen – nicht als Objekte von Politik behandelt werden, sondern als Subjekte mit Stimme.
Es geht um das Recht auf Sichtbarkeit und Präsenz: Versammlungen oder kulturelle Praktiken sind – solange sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen – keine „Störungen“, sondern legitime Aneignungen des Raums, die Vielfalt bereichern.
Ja, es gibt die Probleme auf unseren Straßen, an Bahnhöfen oder in öffentlichen Anlagen. Nur, die Politik kann aus ihrer Verantwortung, in Bildung, Kultur und Sicherheit zu investieren, nicht entlassen werden.
Wer sich politisch äußert, ohne klare Differenzierung, stimmt das Gefühl der Bevölkerung auf den Straßen. Das Konzept der Psychogeografie, geprägt von Guy Debord, geht davon aus, dass das städtische Umfeld ein „unsichtbares Skript“ enthält, das Wahrnehmung und Verhalten lenkt. Wenn Menschen sich innerhalb einer Stadt bewegen, begegnen sie heute räumlichen Manifestationen sozialer Macht und Ohnmacht: Gated Communities, „Problemviertel“ oder teure Neubauquartiere.
Es lohnt sich, derartige Entwicklungen vorurteilsfrei auf sich wirken zu lassen. Das „Herumdriften“ (dérive) – das absichtslose Erkunden der Stadt – dient dazu, diese unterschiedlichen Dynamiken sichtbar zu machen und zu erleben.
Die Beschreibung einzelner Gruppen mittels negativer Bilder – wie dies in den Medien alltäglich geworden ist – birgt die Gefahr, die positive Gestaltungskraft von Migration grundsätzlich zu verleugnen. Migration kann, wenn man genau hinschaut, neue emotionale, kulturelle und affektive Dimensionen in urbane Räume einbringen.
In aktuellen Stadtforschungen, etwa zu „Berliner Topographien“, wird Migration sogar als konstitutiv für das Stadtbild verstanden: Sie prägt nicht nur die ökonomische, sondern auch die kulturelle und emotionale Landschaft einer Stadt.
Durch Spaziergänge, Begegnungen oder Stadterkundungen lässt sich untersuchen, wie Migrantinnen und Migranten – und nicht zuletzt Muslime – Räume gestalten und transformieren. Die direkte Begegnung ersetzt hier die distanzierte Sprache der Bilder. Die Psychogeografie bietet eine emotionale und erkenntniskritische Perspektive auf urbane Räume, die Migration nicht als „Problem“, sondern als bewegende Kraft versteht – eine Kraft, die die kollektive Atmosphäre, die ästhetische Wahrnehmung und das Machtgefüge des Stadtbilds tiefgreifend verändert.
Sie zeigt, wie gelebte Migration in das emotionale Geflecht der Stadt eingeschrieben ist und wie Menschen durch Bewegung, Erinnerung und Wahrnehmung die Stadtlandschaft immer wieder neu schaffen.

Foto: imago/Steinert
Muslimen bietet sich eine Gelegenheit
Für Muslime bietet die Debatte die Gelegenheit, ihre eigene Rolle im Gemeinwesen zu justieren und – wenn nötig – das eigene Verhalten in der Stadt kritisch zu hinterfragen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis unsere religiösen Einrichtungen nicht mehr nur in Hinterhöfen oder Gewerbegebieten zu finden waren.
Heute ist die Funktion der Moschee im Stadtbild vielfältig. Sie ist ein Raum mit Regeln – etwa zur Reinheit, zum Verhalten oder zu spirituellen Übungen. Zugleich ist sie ein offener Ort, der sich als Dienstleister und Begegnungsraum in der Nachbarschaft versteht.
Die Moschee strukturiert den Alltag der Gläubigen durch die Gebetszeiten – eine Form der Zeitordnung, wie Foucault sie als typisch für Heterotopien beschreibt. Das Bauwerk ist einerseits Teil des städtischen Raums, andererseits ein heiliger Ort, der sich von seiner Umgebung abgrenzt. Sie kann damit eine „Gegenplatzierung“ zur säkularen, profanen Welt darstellen.
Wenn sie vollständig in die gesellschaftliche Ordnung integriert ist, verliert sie jedoch ihre „Gegenort“-Funktion und öffnet ihre Türen als Begegnungsraum. Dann wird sie zum Topos, zum gewöhnlichen Ort innerhalb der Ordnung, nicht außerhalb oder gegenüber ihr. Topophilie (aus dem Griechischen tópos = Ort, philia = Liebe) meint die emotionale Bindung der Menschen zu bestimmten Orten – also eine liebende Zuneigung oder tiefe Affinität zu Räumen, die für sie bedeutungsvoll sind.
Diese Orte sind nicht nur geografisch oder architektonisch wichtig, sondern vor allem symbolisch, sinnlich und persönlich aufgeladen. Die Stadt erkaltet ohne solche Räume, in denen es nicht nur um Konsum geht, sondern um wesentliche Sinnfragen des Lebens – mitten in der Stadt. Dass Menschen unterschiedliche kulturelle oder religiöse Entwürfe leben, schützt uns vor der Uniformität, die das technologische Zeitalter hervorbringt.
Es ist wichtig, dass wir Muslime uns nicht nur im Rahmen der Identitätspolitik um uns selbst drehen, sondern uns auf den Stadtraum und die Landschaft um uns herum einlassen.
Auch unsere Einstellung verändert sich, wenn uns bewusst wird, wo wir leben: Die Geschichte unseres Ortes zu verstehen, die Umgebung zu erkunden und das Geistesleben unserer Nachbarschaft aufzunehmen, gehört zu unserem Leben dazu und prägt eine neue Identität. Auf diese Weise tragen wir zu einer Erneuerung der Kultur und zur Sinnstiftung bei.
Auf gesellschaftspolitischer Ebene besteht die Herausforderung darin, jenseits der rein reaktiven Klage, unsere Beiträge für ein harmonisches Zusammenleben und für Problemlösungen zu definieren. Fest steht: Es gibt für rechtschaffene Muslime keinen Grund, sich zurückzuziehen. Vielmehr gehören gesellschaftliches Engagement an dem Ort, an dem wir leben, und vorbildliches Verhalten zu unseren wichtigsten Aufgaben.